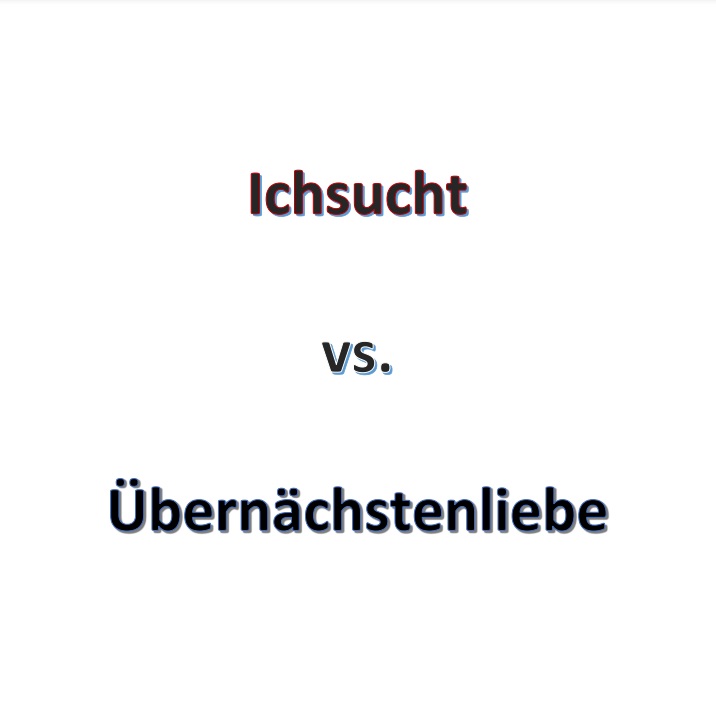Das arme Vogelherz
von Friederike Mey
Niemals erschien eine Großstadt einsamer und kälter, als wenn man mit einem schweren Herz durch ihre lärmenden Straßen eilte. Als ob die geschäftige Welt im Zeitraffer lief, während man sich selbst mit Blei in den Beinen im Gegenwind voran kämpfte.
Jemand hupte Emilia an, als sie einen Zebrastreifen überquerte. An anderen Tagen hätte sie sich vielleicht zum Fahrer umgedreht, seinem Blick durch die milchige Windschutzscheibe gesucht und ihn wütend angestarrt. Meistens fühlte es sich richtig und wichtig an, die Rechte der Fußgänger lautstark einzufordern, aber manchmal – an besseren Tagen – fiel ihr auf, dass dies die Kleinbürokratie des Lebens war und ihre Zwei-Minuten-Wut nicht wert. Diesmal hatte sie bereits die andere Straßenseite erreicht, bis der Hupton überhaupt in ihr Bewusstsein drang.
Emilias Handy piepste. Sie warf einen Blick drauf, ließ es fast fallen. Ihr Mann Thomas war bereits im Krankenhaus, zusammen mit ihrer Tochter Leonie. Sie war nur noch einen Häuserblock entfernt, vorne an der Kreuzung sah sie bereits wie die gewöhnliche Fassade der Straße dem gewaltigen Komplex Platz machte. Ihr Herz, das wie das eines kleinen Vogels geschlagen hatte, war auf einmal weg, vielleicht zu hoch gesprungen, vielleicht aus ihrer Brust gefallen. Sie beschleunigte ihre Schritte.
Die sterile Eingangshalle war fast leer. Ein Mensch ohne Gesicht nickte ihr im Vorbeieilen zu. Der Fahrstuhl fuhr so langsam, als würde er für das öffentliche Amt arbeiten.
Sie hielt Leonie, die Tochter, fest im Arm und gemeinsam schauen sie auf die weiße Gestalt im Bett, das dünne Gespenst, ihr zweites Kind. Kurt schlief und atmete tief, ein gutes Zeichen, wie sie fand. Thomas hatte die Hand auf ihre Schulter gelegt, schien aber nicht genau zu wissen, was er jetzt mit ihr machen sollte. Kurt war nach Kurt Vonnegut benannt, den sie und Thomas in ihrer Jugend angehimmelt hatten wie einen Gott. Sie hatten sich sogar in einem Buchklub der Uni kennengelernt, wo vor allem Kurt Vonneguts Bücher besprochen wurden. Eins nach dem anderen und dann wieder von vorn. Das Resultat ihres ersten, ungelenken Gesprächs drückte jetzt Emilias Hand.
Sie sah zu ihrer Tochter hinunter, Leonie hatte Tränen in den Augen.
„Keine Angst“, sagte Emilia, dabei hatte sie selbst mehr Angst, als sie Worte dafür hatte. Sie küsste ihre Tochter auf die Stirn. Leonie nickte tapfer. Thomas stellte sich neben Kurts Schulter wie ein Wächter.
„Kompatibel”, sagte der Arzt sofort, als er den Raum betrat und Emilia fiel vor Erleichterung schluchzend gegen Thomas’ Schulter. Ihr verkrampftes Herz schwoll zu einem Ballon an und für einen Moment schien alles zu leuchten. Thomas warf den Blick zur Decke und flüsterte etwas, vielleicht ein alter Reflex aus seiner katholischen Erziehung. Er küsste Emilia auf die Wange und sie bückte sich und küsste das Gespenstergesicht von Kurt. Sie hätte den Arzt am liebsten auch noch geküsst. Kompatibel! Fast wie neu.
Der Arzt beobachtete Leonie beim Malen mit Buntstiften.
„Du erinnerst dich vielleicht an letztes Mal, als ich dir und deinen Eltern erklärt habe, dass Kurt etwas in seinem Blut fehlt, und das hat ihn sehr krank gemacht. Er braucht eine Blutspende von jemandem mit genau der richtigen Zusammensetzung.”
Leonie nickte ohne aufzusehen und malte ein grünes Viereck.
„Das Blut deiner Eltern ist nicht kompatibel mit Kurts, aber deins hat positiv getestet. Dank dir kann Kurt also wieder gesund werden.”
Er wedelte mit dem glücklich lächelnden Plüschblutstropfen, den er schon letztes Mal dabeihatte. Zur Veranschaulichung.
Emilia umarmte Leonie fest, die nichts sagte. Emilia wusste, dass sie Angst vor Krankenhäusern und Behandlungen hatte. Sie versuchte, etwas Beruhigendes zu sagen, aber die Erleichterung war so groß und ihr Vogelherz so leicht, dass sie nur unter Tränen lachen konnte.
„Warum überlegst du es dir nicht bis morgen?“, schlug der Arzt vor, der sich zu Leonie hinuntergebeugt hatte.
Leonie warf einen Blick auf Gespensterkurt und nickte, jetzt lächelte sie auch, wenngleich schüchtern. Emilia wollte etwas sagen, bis morgen war es noch eine Ewigkeit, warum überhaupt einen Tag warten. Man sollte Kurt jetzt gleich zu den Lebenden zurückholen – hatte er nicht lange genug gelitten? Aber Thomas drückte ihr leicht auf den Arm, und in ihrer Verwirrung und ihrem Glück sagte sie nichts.
Zuhause, abends, heimlich, stritten Emilia und Thomas sich. Sie fand, dass der extra Tag unnötig war, warum hatte er sie überhaupt abgewürgt. Der Arzt hatte Leonie Zeit und Entscheidungsgewalt geben wollen, erklärte Thomas, man sollte ihm vertrauen. Man könnte immer noch morgen in Ruhe mit Leonie reden, falls sie Fragen hatte. Emilia fand, dass man das dem Arzt nicht unangefochten überlassen könnte, es seien doch ihre Kinder. Plötzlich weinten sie beide, aus Erleichterung, weil es Kurt wieder gut gehen werden würde.
Heute morgen war Leonie sehr schweigsam gewesen, hatte aber mit fester Stimme gesagt, dass sie bereit war, Kurt zu helfen. Die Eltern hatten sie umarmt und geküsst und gesagt, wie stolz sie auf sie seien und dass sie so eine tolle, große Schwester sei. Dass sie keine Angst zu haben brauche und sie würden bei jedem Schritt bei ihr sein.
Emilia fand, dass der Weg zum Krankenhaus noch nie so schön, so leicht gewesen war. Leonie aber war inzwischen überdreht, wollte jedes Laubblatt umdrehen und jeden Käfer anfassen. Das Krankenhaus zog Emilias Herz an wie ein starker Magnet und sie musste sich gegen seine Kraft stemmen, um Leonie einen kleinen, weißen Hund streicheln zu lassen.
„Lass sie”, murmelte Thomas ihr zu. „Sie ist bloß etwas nervös.”
Sie waren fast da.
Der Arzt kommt rein. Seiner Profession angemessen blickt er geschäftig auf ein Klemmbrett voller Zahlen, hebt dann aber den Kopf und lächelt, als er Leonie sieht.
„So ein mutiges Mädchen“, sagt er sanft. Dann blickt er zu den Eltern, die sich stumm in den Armen halten.
„Da Leonie so großzügig zugestimmt hat, werden wir mit der Transfusion sofort beginnen, damit es Kurt bald besser geht. Das heißt, wenn du bereit bist, Leonie“, sagt der Arzt und blickt wieder freundlich auf das Mädchen.
Leonie sucht den Blick ihrer Mutter, dann nickt sie. Emilia seufzt erleichtert.
Man rollt ein zweites Bett und einen großen Apparat in den Raum. Eine Krankenschwester hilft Leonie hinaufzuklettern. Sie desinfiziert ihre Armbeuge und überprüft die Nadel.
„Wie lange dauert es, bis ich sterbe?“, fragt Leonie.
Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Jeder Erwachsene im Raum erstarrt in existentiellem Entsetzen.
„Was meinst du?“, fragt der Arzt so schnell, dass er sich fast verhaspelt.
Emilia und Thomas sind zu überwältig, um auch nur zu blinzeln. Nur die Uhr im Raum tickt laut weiter, sie hat von der Tragik des Augenblicks nichts mitbekommen.
Leonie deutet auf die Nadel, die über ihrer Armbeuge schwebt, gehalten von der erstarrten Krankenschwester.
„Kurt bekommt mein Blut“, sagt sie nüchtern. Der Arzt starrt sie an, er sieht aus, als wäre ihm kotzübel. Leonie runzelt jetzt die Stirn, fast verärgert.
„Ohne Blut kann man doch nicht leben, das weiß ich aus der Schule“, sagt sie.
Thomas bricht in Tränen aus. Er stürzt auf Leonie zu und wirft seine Arme um sie, so hektisch, dass er sich fast in den Infusionskabeln verheddert. Leonie sieht immer noch verwirrt aus. Emilia ist so bewegungslos wie vorher, nur, dass ihr jetzt der Mund offensteht. In ihrem Magen windet sich ein Nest aus Schlangen; und ihr Herz – das arme Vogelherz – ist fest umschlossen von einer kalten, entsetzlichen Hand.
Die Luft im Krankenzimmer hat sich so verdickt, dass sogar das Ticken der Uhrzeiger Mühe hat, sich durchzukämpfen. Inmitten des Stilllebens stößt Kurt das unschuldige Seufzen eines schlafenden Kindes aus. Irgendwo hupt ein Auto. Für lange Zeit weiß keiner im Raum, was er machen soll.