Die dänische Dame
In ihrer Welt gab es nur sie selbst, diese besondere Frau inmitten der sie umgebenden Alltagsmenschen. Einer davon war ich, ihr jüngster Sohn.
*
Der Streit in unserer Familie entbrannte, als wir die Traueranzeige für meinen verstorbenen Vater planten. Sein Tod mit fünfundfünfzig Jahren hatte uns überrascht. Keiner war darauf vorbereitet gewesen, weder einer meiner drei Brüder noch meine Mutter.
Jeder trauerte auf seine Weise um meinen Vater. Das hinderte uns jedoch nicht, um die Gestaltung der Anzeige zu kämpfen wie Kinder um den Platz auf der Gartenschaukel. Alf und Bruno wünschten sich einen Nachruf ohne Schnörkel. Dieter wollte gleich auf alles verzichten, was nach Konvention roch. Mir waren diese Vorschläge zu nüchtern. Ich stellte mir die Anzeige christlich vor, mit einem biblischen Spruch vorweg. Schließlich war mein Vater eifriger Kirchgänger gewesen.
Meiner Mutter waren diese Fragen egal. Sie legte Wert auf unsere Titel, meinen Dr. theol. und Brunos Dr. med. Noch wichtiger für sie war allerdings die Zahl ihrer Kinder. Vier Söhne hatten die wenigsten Mütter aufzuweisen. Das sollte in dem Totenbrief deutlich zum Ausdruck kommen.
*
Meine Mutter hatte schon immer jeden Kaffeeklatsch damit beherrscht, sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Das Märchen von unserer heilen Familie verbreitete sie in der Verwandtschaft, im Freundeskreis und in der Nachbarschaft, wo immer sich dazu die Gelegenheit bot. Wie mich diese Angeberei ankotzte! Ich bin jedes Mal fast ausgeflippt, wenn ich dieses Gehabe um die Familie Perfect mit anhören musste. Konflikte oder gar Streit hatte es bei uns angeblich nie gegeben, weder unter uns Kindern, noch zwischen meiner Mutter und ihrem Adamschatz. Ich wusste jedoch genau, dass meine Eltern jedes Jahr um das gleiche Thema gestritten hatten, nämlich um das Urlaubsziel. Mein Vater wollte unbedingt nach Dänemark, meine Mutter in die Alpen. An ein „Abwechselnd“ war nicht zu denken. Der Kompromiss bestand immer in getrenntem Urlaub: Mein Vater fuhr allein nach Dänemark, während wir Kinder mit meiner Mutter nach Österreich reisten.
Sie hat die Bewunderung der Nachbarsfrauen für ihr rätselhaft konfliktfreies Familienleben sichtlich genossen. Nicht nur der selbst gebackene Apfelkuchen und das stilvolle dänische Porzellan haben ihr Respekt eingebracht, sondern vor allem ihr Erfolg als Mutter von vier Söhnen.
Regelmäßig kam meine Mutter auf ihre Kinder zu sprechen. Dann war sie in ihrem Element. Sie konnte überzeugend reden. Niemand zweifelte an ihren Ausführungen, am wenigsten sie selbst. Ihre vier Söhne waren menschlich voll gelungen, dazu intelligent und gebildet. Sie aber war die Mutter dieser Wunderkinder.
Vier Kinder, die das Abitur geschafft hatten! Vier Kinder, die Akademiker geworden waren, wie ihr Vater! Diesen einen Mann habe sie geliebt, nur ihn. Er sei der leibliche Vater ihrer Kinder. Alles habe seine Ordnung gehabt. Meine Mutter war stolz auf sich.
Wenn sie mit frisch aufgebrühtem Kaffee zu ihren Gästen ins Zimmer trat, hörte ich sie tönen:
Der Familie zuliebe habe ich meine Karriere als Chefsekretärin aufgegeben. Mein Adamschatz und meine Kinder waren mir das wert. Ich hab‘ sie alle vier gleich lieb, vier Kinder, alle klug und gebildet! Und alle vier sind gute Menschen geworden.
Merkte sie denn nicht, wie sehr Karin M., die Nachbarin von gegenüber, unter dem Thema litt. Sie hatte sich vergeblich Kinder gewünscht. Ihr Mann hat mir von ihrem unerfüllten Kinderwunsch erzählt. Alle anwesenden Frauen waren Mütter – außer Karin M. Für sie muss der Kaffeeklatsch eine Tortur gewesen sein. Ich habe mich deswegen für meine Mutter geschämt.
*
Noch mehr habe ich mich geschämt, wenn meine Mutter gegenüber ihrer Schwester zum Angriff überging:
Als Mutter von vier Kindern bin ich natürlich nicht wieder in meinen Beruf zurückgekehrt. Du hast ja noch nebenbei gearbeitet. Dein Ältester hat sich das Leben genommen. Dein Jüngster wollte immer nur dein Geld. Gut, dass der jetzt in Südamerika lebt, weit weg! Das einzige Kind, an dem du Freude haben kannst, ist deine Tochter. Aber die hat ja mit ihrem ersten Mann auch Pech gehabt. Und ihr Sohn, dein Enkel, hat ebenfalls den falschen Geschmack in der Hose.
Den Konkurrenzkampf zwischen den beiden Schwestern habe ich erst viel später verstanden. Meine Tante war fünf Jahre jünger als meine Mutter und hat ihr als „unsere süße Kleine“ in der Kindheit oft die Schau gestohlen. Dann war meine Mutter abgemeldet.
Von uns Brüdern bin ich der Jüngste. Auch ich habe meine Rolle als Nesthäkchen genossen. Mit Charme und Witz habe ich die Erwachsenen um den Finger gewickelt. Was blieb mir anderes übrig bei der geballten körperlichen Übermacht meiner drei älteren Geschwister!
Der Anerkennungskampf zwischen meiner Mutter und ihrer Schwester hat mich mein Leben lang begleitet. Wenn meine Mutter mal wieder besonders aufgetrumpft hatte mit ihren vier Kindern und ihrem gebildeten Adamschatz, stellte meine Tante uns Kinder kurzerhand Rücken an Rücken, meinen Cousin Norbert und mich. Dabei schnitt ich schlecht ab, denn mein Cousin überragte mich stets um mindestens zwanzig Zentimeter, obwohl er zwei Jahre jünger war als ich.
*
Von ihrem Mann sprach meine Mutter oft mit verklärtem Blick. Meist verpasste sie meinem Vater einen Heiligenschein, wenn sie sich selbst mal wieder das goldene Mutterkreuz verlieh. Noch heute zehrt sie von der Ehe mit ihrem Adamschatz. Die Erinnerung an ihn zaubert stets ein Lächeln in ihr Gesicht, wenn sie von ihm spricht:
Der beste Ehemann der Welt!
Doch auch ihm gegenüber kannte sie keine Gnade, wenn ihr Lieblingsthema auf den Tisch kam: der Ahnenpass, Beweis für ihr arisches Wesen. Dann erzählte sie von ihrem ersten vergeblichen Heiratsversuch:
Ein Alptraum! Der Standesbeamte – er trug ausgerechnet den Familiennamen Christ – hat uns beide, mich und meinen Adamschatz, wieder weggeschickt, ohne uns zu trauen.
Den 1942 erforderlichen Nachweis arischer Reinrassigkeit hatte mein Vater nicht führen können. Bis heute kommentiert meine Mutter das Malheur unverändert:
Bei mir war ja alles in Ordnung. Aber mein Adamschatz konnte keinen Ahnenpass vorweisen.
*
Jeder Mensch aus ihrer unmittelbaren Umgebung bekam irgendwann sein Fett ab. Das bevorzugte Opfer meiner Mutter war Gertrud, ihre beste Freundin. Zugegeben: Sie war nach dem Tode ihres Mannes dem Alkohol verfallen. Das war unübersehbar. Die Ärmste wurde offenbar mit ihrem Witwendasein nicht fertig. Meine Mutter fühlte sich jedoch von dem Alkoholkonsum und seinen Folgen abgestoßen und verurteilte dieses Verhalten:
Die lässt sich gehen. Die hat keine Selbstdisziplin. Ihr Sohn hat ja alles versucht. Aber der hat inzwischen auch kapituliert.
*
Ausländische Frauen drohten zur Gefahr zu werden – zumindest in der Welt meiner Mutter. Ihre Worte waren immer die gleichen, wenn sie von ihrem Wochenendeinkauf zurückkehrte:
Unsere Stadt ist bald voll in der Hand von Ausländern. Die überschwemmen unsere Straßen. Im Supermarkt sieht man fast nur noch Frauen mit Kopftüchern. An den Bushaltestellen drängeln sie sich vor, wenn man einsteigen will. Und in den Bussen besetzen sie die Sitzplätze. Diese Tussis denken nur an sich. Glaubt ja nicht, jemand von denen steht für mich ältere Frau auf und bietet mir ihren Platz an.
Wenn meine Mutter dann so richtig in Fahrt war, trieb sie ihre Klage auf die Spitze:
Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die kriegen alles hinten reingeschoben: reichlich Bares aus unseren Steuergeldern und Luxuswohnungen mietfrei. Unsereins muss dafür auf ehrliche Art Geld verdienen.
Sie war selbst Ausländerin, meine Mutter. Doch diese Wahrheit habe ich ihr erst nach dem Tode meines Vaters entlocken können. Bis dahin wusste ich nur: Ihre Kindheit hatte meine Mutter in Dänemark verbracht, in Skagen, wo sich meine Eltern kennengelernt hatten.
*
Zurück zum Tag der Beerdigung! Der Leichenschmaus war überstanden. Bruno und Dieter hatten sich mit ihren Familien bereits verabschiedet. Meiner Mutter war die Erschöpfung anzusehen. Dennoch stellte ich ihr die Frage, die seit der Trauerfeier für meinen Vater in mir brannte:
Wer war die Dame mit dem dunkelblauen Hut, die bei der Trauerfeier ganz hinten in der letzten Bank saß?
Ein Anflug von Vorwurf zog über das Gesicht meiner Mutter, bevor sie antwortete:
Jörrel Blomstedt, eine Verwandte aus Dänemark. Sie lebt in Skagen und ist deine Halbschwester.
*
Meine Halbschwester? Das konnte nur eins bedeuten: Mein Vater hatte ein Doppelleben geführt. War Dänemark für ihn mehr als ein lieb gewonnenes Urlaubsziel gewesen?
Eine weitere Frage drängte sich mir auf: Was wollte diese Jörrel hier in Oldenburg auf der Beerdigung? Trauern? Abschied nehmen? Ihre Erbansprüche durchsetzen? Unsere Familie in Misskredit bringen?
Noch ehe ich mich durchgerungen hatte, mit der neuen Halbschwester Kontakt aufzunehmen, war Jörrel Blomstedt abgereist. Ich hätte sie damals gern kennengelernt.
*
Während wir beide hier in Skagen, wo zwei Meere aufeinandertreffen, Salzwasser um unsere Zehen spülen lassen, wächst der Strand von Minute zu Minute mehr aus der geriffelten Wellenoberfläche heraus. In zwei Stunden ist Niedrigwasser. Bis dahin wird die Ebbe den Sand ganz freilegen. Meine Halbschwester kennt sich aus mit den Gezeiten. Sie ist hier aufgewachsen. Ihren Vater hatte sie jedes Jahr im Sommer vier Wochen für sich gehabt.
Ich habe gelernt, meine Mutter mit den Augen meines Vaters zu sehen. Sie kannte sein Geheimnis.
***

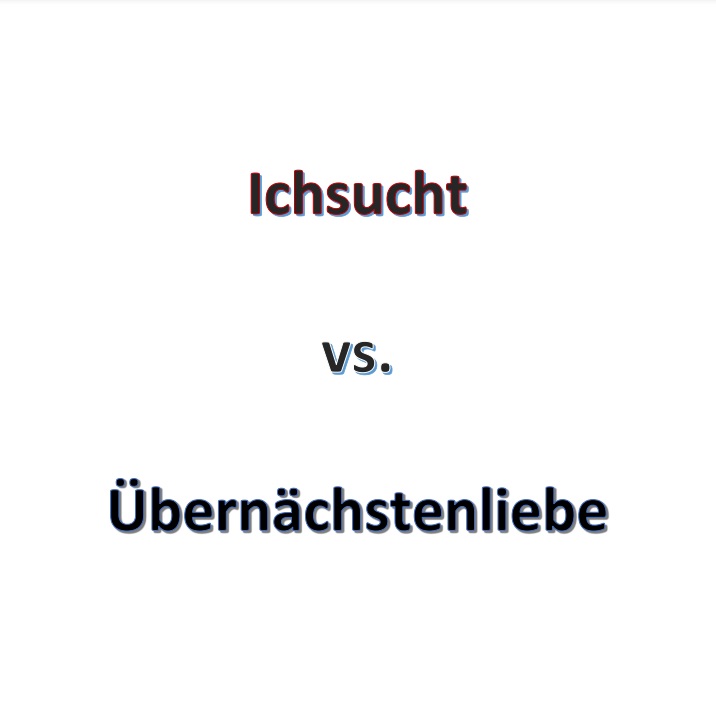
One thought on “Die dänische Dame”