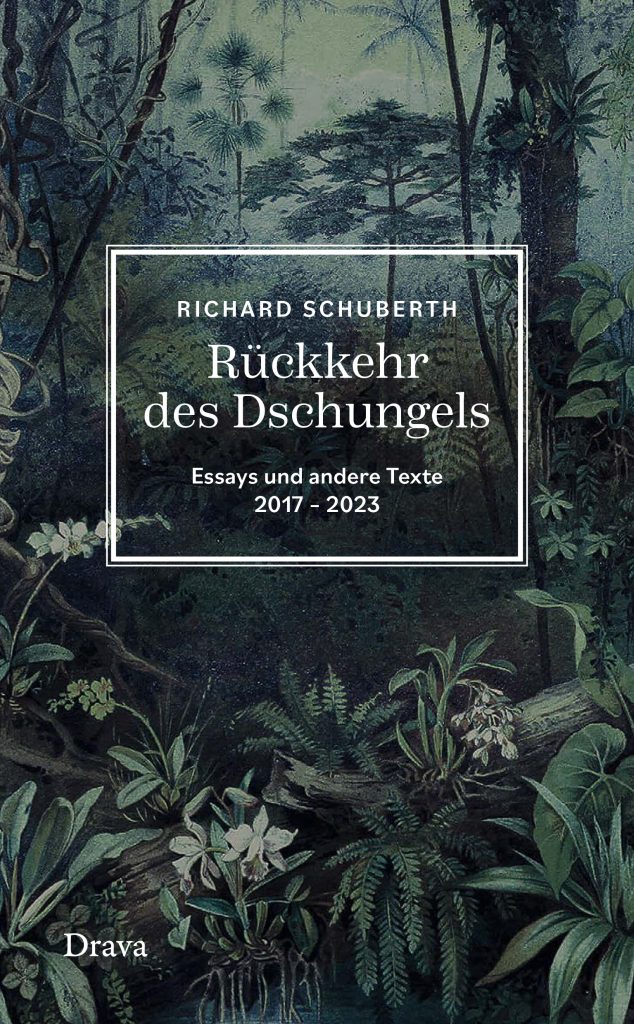Mehr schlechte Vorstellung als guter Wille – oder umgekehrt?
Rezension von Dieter Feist
Richard Schuberth: Rückkehr des Dschungels. Essays und andere Texte 2017-2023. Drava, Klagenfurt 2023. 452 Seiten, 21 Euro.
Vor mir liegt ein dickes, gebundenes Buch, Hardcover, mit schön gestaltetem Schutzumschlag und Lesebändchen (Kompliment an den Verlag). Beim Hineinblättern fällt als erstes auf, dass der Titel innen anders lautet als außen: „Die Welt als guter Wille und schlechte Vorstellung. Ein identitätspolitisches Lesebuch“ heißt es auf Seite drei. Auf dem Buchrücken und auf dem Umschlag steht: „Rückkehr des Dschungels. Essays und andere Texte 2017-2023“. Zweitausenddreiundzwanzig? Erscheinungsjahr ist laut Verlag 2022. Nachdem hinten im Buch kein zusätzliches Geheft beigeklebt ist („…um die neuesten Entwicklungen nicht unberücksichtigt zu lassen, sehen wir uns veranlasst…“), wird es sich um ein Versehen handeln, Tippfehler, zu spät bemerkt, sollte nicht, aber kann. Oder der Autor hat zuallerletzt noch Texte aufgenommen… Egal. Äußerlichkeiten.
Wer ist Richard Schuberth? Klappentext. Aha, ein Österreicher. Ist nicht herablassend gemeint, schließlich wissen wir Deutschen, was wir an österreichischen Essayisten haben. Ihre Bissigkeit zum Beispiel. Im hinteren Buchumschlag gibt es ein Portrait; der Autor hinter einem üppigen Bund Ähren, eine ragt von der Seite so ins Bild hinein, als ob er damit salutieren wollte. Gefällt mir. Auch wie er aus dem Foto herausguckt. Herausfordernd irgendwie. Aber das sind schon wieder Äußerlichkeiten, deswegen auch nichts mehr über die Bilder von ihm, die ich im Internet gefunden habe. Ein Österreicher also, und vermutlich bissig. Ich kenne das: pass auf, dass du ihnen nicht zu nahe kommst, es könnte da ein Spiegel sein, den du auf die Nase kriegst.
Richard Schuberth hat recht. Womit? Naja, eigentlich mit allem oder zumindest mit vielem, was er schreibt. Wenn ich in diesen Essays so herumlese, kommen viele Dinge zur Sprache, die auch mich schon beschäftigt haben und es kommt mir so vor, als wären wir öfter ähnlicher Meinung. Mir scheint, er hat auch recht mit den Sätzen, die ich zweimal lesen muss, weil ich am Ende vieler Zeilen zwar das Prädikat des Hauptsatzes erkannt habe, mich allerdings nicht mehr an das Subjekt erinnern kann. Liegt wahrscheinlich an mir.
Richard Schuberth arbeitet sich an vielen Themen entlang (ich streiche: „ab“), die von „der Linken“ diskutiert werden, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass er sich nicht gerne als im landläufigen Sinne links bezeichnen ließe. Und so einfach ist diese links-rechts-Kategorisierung ja sowieso nicht mehr wie in den seligen Zeiten, da man sich sicher war, wo man zu stehen hatte und warum, und das auch schlüssig in Worte fassen konnte. Die Grenzen sind nebulös, und wenn man nicht aufpasst, steht man ganz schnell in einer Ecke, in die man nicht gestellt werden wollte. Insofern ist Schuberth offensichtlich doch ein Linker, indem er linke Positionen (oder das, was man gern dafür gehalten hätte) bedarfsweise attackiert und in Ecken stellt; unliebsame selbstredend.
Aber was sind nun Richard Schuberths Ansichten? Schauen wir auf seine Inhalte, einen ersten Hinweis gibt der Untertitel des Buchs: „Ein identitätspolitisches Lesebuch“. Was ist das, Identitätspolitik?
Identität erstmal, ist ja eigentlich ganz einfach, äh… also alles, was ein Individuum so hat und ist und denkt und war und sein will… zum Beispiel wenn Sie mich nehmen, ich sehe so und so aus, ich habe Meinungen und natürlich gibt es meine Eigenheiten und das alles zusammen ist dann sozusagen meine Identität. Gibt’s auch für Gruppen. Ich gehöre zum Beispiel zu einer mit lauter Leuten, die ähnliche Meinungen haben wie ich und komische Eigenheiten wie ich, ohne dass ich jetzt speziell jemanden davon kennen würde. Ich bin auch nicht der Gründer dieser Gruppe, ich habe auch keinen Aufnahmeantrag gestellt, eigentlich habe ich mit niemanden von denen persönlich etwas zu tun. Hier kommt die Politik ins Spiel, respektive die Parteien, denn die wollen, dass ich, oder wir… Die Parteien überhaupt, die ehemals „großen“, sie kranken doch daran, dass es keine proletarischen, bürgerlichen oder christlich-konservativen Milieus mehr gibt, deren Identität sie vertreten könnten. Das fällt den Rechtsparteien leichter, die den Blöden nach dem Mund reden und ihnen eine Identität aufschwatzen.
So sitze ich mindestens eine Viertelstunde herum und versuche etwas in Worte zu fassen, das man nicht in Worte fassen kann, jedenfalls nicht in wenige griffige, weil es sich um eine archetypische Phrasenblase handelt: klingt gut, sagt aber praktisch nichts. Gut zum Klugscheißen, weil von flattriger Bedeutung. Findet Richard Schuberth auch: „Die Rede von der Identität gehört zu den größten Unsinnigkeiten, die aus den wissenschaftlichen Laboratorien des 20. Jahrhunderts entwischen konnten. […] Bereits die Begriffswahl ist ein Fehlgriff, denn die Identität entstammt der Logik und bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass eine Sache mit sich identisch sei.“ Eine ‚leere Tautologie‘ nennt Hegel das, schreibt Schuberth.
„Identitätspolitik ist ein Reizthema“, behauptet die (deutsche) ‚Bundeszentrale für politische Bildung‘, es sei, „als betrete man unausweichlich vermintes Gelände, sobald man sich zu ihr äußert.“ Ich wage mal die Behauptung, dass ein Autor wie dieser Richard Schuberth, der ein solches Portrait von sich in den Buchumschlag drucken lässt, vermintes Gelände schätzt – je mehr Detonationsmöglichkeiten, desto besser –, sich aber selbst so geschickt darin zu bewegen weiß, dass es tunlichst die Leserschaft ist, die hinein tritt. Es besteht der Verdacht, dass die eine oder andere Mine bedachtsam unter die Sohle manövriert wird. Das ist nicht die Hinterfotzigkeit niederbayerischer Satiriker, aber genauso wirkungsvoll und ebensowenig feinsinnig.
Worum geht es also? Um dich und mich, um die Grüppchen und Gruppen, denen wir nolens volens zugerechnet werden? Das Private – wir wissen es längst – ist politisch und das Politische privat, alles dazwischen, die diversen Identitäten sowieso, in wechselnden Anteilen. Ein weites Feld, sehr weit. Der Titel des Buchs „Die Welt als guter Wille und schlechte Vorstellung“ lässt vor diesem Hintergrund einen thematischen Gemischtwarenladen befürchten. Klingt abfällig, soll aber nicht, denn Richard Schuberth ist ja Essayist. Und nach der Konstatierung des Generalthemas als in höchstem Maße diffus lässt sich unter diesem Buchtitel (und noch mehr unter dem anderen, auf dem grünen Umschlag) quasi über alles schreiben. Ich mag so etwas. Bücher, in denen über 450 Seiten nur eine einzige Sache abgekaut und durchgefrühstückt wird, lese ich nur, wenn ich muss.
Wovon ist nicht alles die Rede: von Nationalismus natürlich, von Migration, Wokeness, kultureller Aneignung, MeToo, von den perversen Auswüchsen sozialer Medien und von toxischer Männlichkeit. Kaum etwas bleibt unbesprochen, unbeschrieben, was in den heutigen Zeiten nicht bedenkens-, besprechens- und eventuell empörenswert wäre, und Schuberth ergreift – wie es einem Essayisten zukommt – die Chance zur thematischen Offenheit beim Schopf, um gedanklich gehörig auszuschweifen. Und wie! Nicht nur gedanklich.
Die Sprache ist virtuos aber auch wuchtig, Argumente werden nicht mit dem Florett herumgewedelt, sondern eingerammt, und zwar oft unvermittelt da, wo man sie als Leser nach geschickten syntaktischen Wendungen des Autors bestimmt nicht erwartet hätte. Wenn ich mal als Analogie die Musik heranziehen darf, dann würde ich den präzisen, akzentuierten Anschlag und die große Fingerfertigkeit anerkennend konstatieren, allerdings auch anmerken, dass eine bedacht gesetzte Pause die Töne vorher und nachher erst richtig hervorheben kann, und ein pianissimo ein folgendes forte nur noch wirkungsvoller macht.
Und, um bei der Musik zu bleiben, eine Anthologie ist das, was man im Musikgeschäft einen Sampler nennt: Stücke aus verschiedenen Zeiten und Zusammenhängen kommen zu Gehör. Ein interessanter Überblick, aber ein Zusammenschnitt unterschiedlicher Provenienzen. Die eine Nummer hätte man gern im Zusammenhang des ehemals erschienenen Konzeptalbums gehört, einer anderen merkt man an, dass der Sound nicht mehr ganz der aktuelle ist. Ein paar Stücke treffen nicht meinen Geschmack, etliche andere wiederum höre ich mir gerne öfter an. Insgesamt entsteht der Wunsch, den Künstler einmal „live“ zu erleben, wenn er sich nicht hinter Studioproduktionen verstecken kann.
So geht es mir mit Richard Schuberth. Ich könnte ihn mir mit seiner virtuosen Sprachgewalt auf einer Bühne vorstellen, und das wäre wahrlich etwas anderes als diese inhaltslauen Figuren, die heute das politische Kabarett repräsentieren. Schuberths Texte lesen sich so, dass man sie gern gesprochen hören möchte.
Irgendwann vor langer Zeit ist er als Kabarettist aufgetreten, macht er nicht mehr, schade, aber man kann es nachvollziehen; einem Publikum, das gestern im Ersten Nuhr beklatscht hat, möchte ich morgen keine Perlen vorwerfen müssen, die es für Saubohnen hält. Hören kann man ihn trotzdem: Kapitel drei des Buchs „Lord Nylons Schlüsseldienst“ sind gesammelte Radiokolumnen von 2020, die unter gleichem Namen in der ORF-Mediathek zu finden sind.
Auf einem anderen Blatt stehen die im Buch abgedruckten Cartoons, die sich natürlich jeder Möglichkeit einer Live-Performance entziehen. Zwar sind sie noch mehr als die Texte in Gefahr des bald-nicht-mehr-aktuell-Seins, aber im Unterschied dazu sind sie durch die textliche und optische Reduktion umso treffsicherer. Auch Schuberths Zeichenfeder ist spitz.
Was also schreibe ich zum Schluss über ein solches sprachlich und inhaltlich pralles Lesebuch?
„Wer zwei paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.“ Das Lichtenberg-Diktum würde ich so modifizieren: Wer politisch pointierte, sprachlich geschliffene Essays schätzt, der behalte seine zweite Hose und kaufe dieses Buch trotzdem. Zum einen, weil um das Geld keine Hose zu kriegen ist, wenn doch wieder eine zweite vonnöten ist, zum anderen, weil das Buch voller Anregungen und Denkanstöße steckt, selbst wenn man dem Autor nicht allem zustimmt. Und wenn einige der Essays schon etwas betagt wirken, sind sie doch insofern interessant, als man sich schmunzelnd erinnert, worüber vor ein paar Jahren geschnappatmet wurde.
Aber, wie gesagt, Vorsicht, der Mann ist Österreicher, er ist bissig und beim Lesen könnte man auf vermintes Gelände geraten. Wer jedoch politische Essays schreibt, darf nicht harmoniebedürftig sein, muss Stellung beziehen und widerständig sein. Am Schluss des Buchs stellt Schuberth unmissverständlich klar:
„Widerstand heißt konkret auch, den erbärmlich dummen Auswüchsen der Identitätspolitik mit toxischem Spott zu begegnen … die aus allen Poren der sozialen Medien und des neuen Aktivismus trenzende und triefende Selbstgefälligkeit und Wichtigmacherei mit allen zu Verfügung stehenden Mitteln zu verspotten…“
Das allein genügt schon als Empfehlung.
Und nochmal, von wegen „live“: hört ihn euch mal an, den Schuberth, oe1orf.at/lordnylon oder so ähnlich, ihr werdet’s schon finden; lohnt sich.