Protagonistenblicke
Geschichte von Anna-Lena Eißler
Er ist sich nicht einmal eine Exposition wert.
Die Uhr hat zu leise getickt. Eben ist es noch 4:20 Uhr und dann doch 5:30 Uhr. Er muss eigentlich schon am Bahnhof sein, während er nach dem Haustürschlüssel auf dem Esstisch, in den Schränken und sogar in der Waschmaschine sucht und dann doch eine leere Rolle Klopapier in die Tür klemmt.
Es ist noch dunkel, die Straßen sind verlassen. Wenigstens keine Menschenmassen, durch die er sich seinen Weg bahnen muss, wie zu Sonderschichten an Feiertagen. Massen, die sich sonst manövrieren, um am Alltagsdrama teilzuhaben, und ihm seine Rolle zuweisen. Mit jedem ihrer abschätzigen Blicke.
Ein Betrunkener taumelt ihm entgegen und deutet auf seine Uniform ,und er ist sich fast sicher, wessen Erbrochenes er oder seine Kollegen an diesem Morgen aus einem Abteil wischen werden müssen. Er sprintet durch leichten Nieselregen, durch Pfützen, spürt Wasser die Hose hochspritzen. Der Himmel ist grau und endlos wie der Asphalt.
Dann ist er am Bahnhof, winkt dem Kollegen. Begrüßt ihn, für ein schnelles „Hallo!“ ist noch Zeit. Ein Lächeln auf der anderen Seite, das genauso falsch ist wie das eigene.
Der Zug rauscht über die Schienen, er sieht die Landschaft an sich vorbeiziehen. Hier hebt sich der Vorhang für ihn. Zumindest für wenige Sekunden, wenn er nach dem Getränkewunsch fragt.
Kühe, Felder, Großstädte, nur Sekunden, bevor sie hinter grün oder grau verschwinden.
Wenn er Pause hat, sitzt er still da und liest sich Beschwerden über Verspätungen durch. Während seiner Ausbildung musste er diese beantworten. Immer wieder es tut mir leid, es hat sich ihm immer weiter aufgedrängt, sich in die Zahnräder des Verstands geklemmt. Sie knarren und kreischen Tag für Tag, wenn er wieder den Bahnhof verlässt, mit dem Finger auf ihn gedeutet wird. Blicke von ganz oben nach ganz unten. Protagonistenblicke.
Was kann ich Ihnen bringen? Schön, dass Sie mit uns reisen. Die Waschräume? Sie müssen nur den Gang weiter runter, genau da, und dann sehen Sie links das Schild.
Die Leute sehen ihn an und ziehen die Brauen zusammen, es ist mehr ein Befehl als eine Bitte, dass er gehen soll. An guten Tagen bekommt er ein Nicken, an sehr guten Tagen ist es ein dankbares Nicken.
All die sitzenden Reisenden sind die Protagonisten des Alltagsdramas, jeder für sich. Jeder von ihnen hat ein Ziel, wenn sie aus diesem Zug steigen, werden sie einem vor- oder selbstbestimmten Pfad folgen. Die Mitreisenden, das sind Nebencharaktere, jeder für alle anderen. Die Mitreisenden, sie haben grobe Eigenschaften, werden aus Ferne und Nähe beobachtet, am liebsten, wenn man eine Zeitung oder ein digitales Gerät hat, hinter dem man sich verstecken kann. Wie etwas das schreiende Kind und die wenig interessierte Mutter. Jugendliche, die sich unterhalten als wären sie als Baby bei den Primaten ins Gehege gefallen und das lustig finden. Der Rentner, der das gar nicht lustig findet und mit dem Spazierstock droht. Dazu der Businessmanager, der auf dem Touchpen kauend vor seinem IPad sitzt und die Augen schließt, um sich auf die Alphawellen aus den AirPods zu konzentrieren. Nebenrollen.
Und er?
Er ist einer der charakterlosen Anzugträger. Er kann nur eine bestimmte Anzahl von Sätzen, „Sehr gerne, vielen Dank, bitte, nein, dieser Platz ist leider vorreserviert. Ihr Platz ist ein anderer.“ Er ist es nicht einmal wert, sich darüber aufzuregen. Ein Gesicht unter vielen, man sieht hinein und vergisst es, sobald man wegblickt. Man nimmt ihn wahr, und doch taucht er in keiner Erzählung auf, er gehört zu „Zugfahren“ dazu, als sei er ein eingebautes Teil, niemand, der am Morgen den Schlüssel seiner Wohnungstür verlegt hat.
Seine Auftritte sind kurz und vom Willen der Protagonisten bestimmt.
Ihr Ja, Nein, Vielleicht, bestimmt seinen Tagesablauf, betreibt die Kolben des mechanisierten Alltags, ein nettes Danke ist das Öl im Getriebe.
Er ist ein Alltagsstatist.
Die junge Frau, die zum Abschied die Hand gehoben hat, am Münchner Hauptbahnhof. Es ist schon sechs Monate her, aber er hat sie nicht vergessen, wie könnte er auch, sie trug einen gelben Mantel. Knallgelb, nicht pastell. Ein Mantel, der gesehen werden wollte, und er war dieser Aufforderung gefolgt. Eine automatische Reaktion.
Er ist sich nicht einmal eine Exposition wert.
Die Uhr hat zu leise getickt. Eben ist es noch 4:20 Uhr und dann doch 5:30 Uhr. Er muss eigentlich schon am Bahnhof sein, während er nach dem Haustürschlüssel auf dem Esstisch, in den Schränken und sogar in der Waschmaschine sucht und dann doch eine leere Rolle Klopapier in die Tür klemmt.
Es ist noch dunkel, die Straßen sind verlassen. Wenigstens keine Menschenmassen, durch die er sich seinen Weg bahnen muss, wie zu Sonderschichten an Feiertagen. Massen, die sich sonst manövrieren, um am Alltagsdrama teilzuhaben, und ihm seine Rolle zuweisen. Mit jedem ihrer abschätzigen Blicke.
Ein Betrunkener taumelt ihm entgegen und deutet auf seine Uniform ,und er ist sich fast sicher, wessen Erbrochenes er oder seine Kollegen an diesem Morgen aus einem Abteil wischen werden müssen. Er sprintet durch leichten Nieselregen, durch Pfützen, spürt Wasser die Hose hochspritzen. Der Himmel ist grau und endlos wie der Asphalt.
Dann ist er am Bahnhof, winkt dem Kollegen. Begrüßt ihn, für ein schnelles „Hallo!“ ist noch Zeit. Ein Lächeln auf der anderen Seite, das genauso falsch ist wie das eigene.
Der Zug rauscht über die Schienen, er sieht die Landschaft an sich vorbeiziehen. Hier hebt sich der Vorhang für ihn. Zumindest für wenige Sekunden, wenn er nach dem Getränkewunsch fragt.
Kühe, Felder, Großstädte, nur Sekunden, bevor sie hinter grün oder grau verschwinden.
Wenn er Pause hat, sitzt er still da und liest sich Beschwerden über Verspätungen durch. Während seiner Ausbildung musste er diese beantworten. Immer wieder es tut mir leid, es hat sich ihm immer weiter aufgedrängt, sich in die Zahnräder des Verstands geklemmt. Sie knarren und kreischen Tag für Tag, wenn er wieder den Bahnhof verlässt, mit dem Finger auf ihn gedeutet wird. Blicke von ganz oben nach ganz unten. Protagonistenblicke.
Was kann ich Ihnen bringen? Schön, dass Sie mit uns reisen. Die Waschräume? Sie müssen nur den Gang weiter runter, genau da, und dann sehen Sie links das Schild.
Die Leute sehen ihn an und ziehen die Brauen zusammen, es ist mehr ein Befehl als eine Bitte, dass er gehen soll. An guten Tagen bekommt er ein Nicken, an sehr guten Tagen ist es ein dankbares Nicken.
All die sitzenden Reisenden sind die Protagonisten des Alltagsdramas, jeder für sich. Jeder von ihnen hat ein Ziel, wenn sie aus diesem Zug steigen, werden sie einem vor- oder selbstbestimmten Pfad folgen. Die Mitreisenden, das sind Nebencharaktere, jeder für alle anderen. Die Mitreisenden, sie haben grobe Eigenschaften, werden aus Ferne und Nähe beobachtet, am liebsten, wenn man eine Zeitung oder ein digitales Gerät hat, hinter dem man sich verstecken kann. Wie etwas das schreiende Kind und die wenig interessierte Mutter. Jugendliche, die sich unterhalten als wären sie als Baby bei den Primaten ins Gehege gefallen und das lustig finden. Der Rentner, der das gar nicht lustig findet und mit dem Spazierstock droht. Dazu der Businessmanager, der auf dem Touchpen kauend vor seinem IPad sitzt und die Augen schließt, um sich auf die Alphawellen aus den AirPods zu konzentrieren. Nebenrollen.
Und er?
Er ist einer der charakterlosen Anzugträger. Er kann nur eine bestimmte Anzahl von Sätzen, „Sehr gerne, vielen Dank, bitte, nein, dieser Platz ist leider vorreserviert. Ihr Platz ist ein anderer.“ Er ist es nicht einmal wert, sich darüber aufzuregen. Ein Gesicht unter vielen, man sieht hinein und vergisst es, sobald man wegblickt. Man nimmt ihn wahr, und doch taucht er in keiner Erzählung auf, er gehört zu „Zugfahren“ dazu, als sei er ein eingebautes Teil, niemand, der am Morgen den Schlüssel seiner Wohnungstür verlegt hat.
Seine Auftritte sind kurz und vom Willen der Protagonisten bestimmt.
Ihr Ja, Nein, Vielleicht, bestimmt seinen Tagesablauf, betreibt die Kolben des mechanisierten Alltags, ein nettes Danke ist das Öl im Getriebe.
Er ist ein Alltagsstatist.
Die junge Frau, die zum Abschied die Hand gehoben hat, am Münchner Hauptbahnhof. Es ist schon sechs Monate her, aber er hat sie nicht vergessen, wie könnte er auch, sie trug einen gelben Mantel. Knallgelb, nicht pastell. Ein Mantel, der gesehen werden wollte, und er war dieser Aufforderung gefolgt. Eine automatische Reaktion.
Ein Winken, und er sieht diese Szene vor sich. Ist es wegen seines Statistendaseins?
Dass sie die Hand gehoben hat, war das nur eine Geste, um Verwirrung zu stiften? Oder macht sie das immer, und es war sein Statistenglück, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand?
Diese Protagonisten, er stellt sich vor, wo sie schon überall waren.
Das junge Mädchen mit den geflochtenen Zöpfen stand sicher schon einmal auf einer der Weiden, auf denen die Kühe stehen. Vielleicht hat sie sogar eine Kuh gestreichelt und einem Kälbchen eine Glocke umgehängt. Vielleicht ist sie durch das Gras gerannt, musste dann heftig niesen und hat so festgestellt, dass sie unter Heuschnupfen leidet. Zurück in die Arme ihres Vaters. Sie fährt in die Großstadt zu ihrer Mutter, zu einer neuen Schule.
Oder eben nicht.
Aber sie wird ihn sehen, und sie wird ihn vergessen, sie wird sich nicht fragen, ob er heute Morgen durch den Regen gesprintet ist, wird sich nicht die Schlammflecken ganz unten an den Hosenbeinen ansehen und sich fragen, warum er den Pfützen nicht ausgewichen ist. Sie wird sich fragen, wann er endlich mit der bestellten heißen Schokolade zurück ist. Er ist doch nur ein Statist, an den Zug gebunden. Ein Bühnenbild, wenn man es so will.
Dieses Alltagsdrama hätte in einem Review wenigstens das Lob „Realistische Darstellung“ bekommen.
Oft steht er an der Tür und verabschiedet die Fahrgäste, dabei stellt er sich vor, wie es wäre. Wie es wäre, ebenfalls den Schritt über die Schwelle zu wagen. Dem Statistendasein zu entsagen.
Ein Protagonist sein und seinen eigenen Weg bestimmen, wohin ihn seine Füße an diesem Tag lenken. An einem unbekannten Ort zuhause sein und sich in jede zwischenmenschliche Begegnung frisch verlieben.
„Tschüss, auf Wiedersehen, schön, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben“, sagt er stattdessen wieder und wieder, bis er Fuseln auf der Zunge spürt.
Wieder und wieder, Tag für Tag, Ausstieg für Ausstieg. Ein ewiger Teufelskreis.
Es ist nur ein Schritt, und jedes Mal verpasst er die Zeit zum Absprung.
Eine viel zu große Regelmäßigkeit. Ist es, weil er den Zug nicht verlassen kann, weil er an ihn gebunden ist?
Er hat den Zug und er hat die Klagen.
Würde er jemals in eine Talkshow eingeladen werden, genau darüber könnte er sprechen. Zu stressig, die Gäste sind zu undankbar und der Zug seine Heimat.
„Und wenn Sie nun einfach aussteigen und… den Job wechseln?“, könnte der Moderator fragen, es würde Schweigen folgen.
„Es gehört zu mir.“
„Wie meinen Sie das? Das Zugfahren oder die ständigen Beschwerden?“
„Beides.“
Klagen sind wie rote Fahnen, man kann sie schwenken und hat für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit aller Umstehenden. Dann muss der Statist seinem ziellosen Streben nachgehen, damit die Protagonisten ihn miteinbeziehen können, miteinbeziehen in das Wort „Zugfahren.“
Fast ist er glücklich, dass er kein auffälliger Statist sein kann, da ihm dieses Merkmal laut der modernen Dramenstruktur nicht zu Grunde liegt. Umgekehrter Egoismus ist ihm nicht verboten, er darf die Klagen und die eigene Unvollkommenheit auf eine schmerzhafte Weise lieben.
Er ist nicht unsichtbar, aber schwer erkennbar, er beklagt sich immer wieder, hört gar nicht mehr auf damit und wird dennoch nicht erhört. Eine konstante Parallele zu den Interessen seiner Vorgesetzten, vielleicht gegenläufig, das mag sein, aber es wird niemals einen Schnittpunkt geben.
Ein Winken, und er sieht diese Szene vor sich. Ist es wegen seines Statistendaseins?
Dass sie die Hand gehoben hat, war das nur eine Geste, um Verwirrung zu stiften? Oder macht sie das immer, und es war sein Statistenglück, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand?
Diese Protagonisten, er stellt sich vor, wo sie schon überall waren.
Das junge Mädchen mit den geflochtenen Zöpfen stand sicher schon einmal auf einer der Weiden, auf denen die Kühe stehen. Vielleicht hat sie sogar eine Kuh gestreichelt und einem Kälbchen eine Glocke umgehängt. Vielleicht ist sie durch das Gras gerannt, musste dann heftig niesen und hat so festgestellt, dass sie unter Heuschnupfen leidet. Zurück in die Arme ihres Vaters. Sie fährt in die Großstadt zu ihrer Mutter, zu einer neuen Schule.
Oder eben nicht.
Aber sie wird ihn sehen, und sie wird ihn vergessen, sie wird sich nicht fragen, ob er heute Morgen durch den Regen gesprintet ist, wird sich nicht die Schlammflecken ganz unten an den Hosenbeinen ansehen und sich fragen, warum er den Pfützen nicht ausgewichen ist. Sie wird sich fragen, wann er endlich mit der bestellten heißen Schokolade zurück ist. Er ist doch nur ein Statist, an den Zug gebunden. Ein Bühnenbild, wenn man es so will.
Dieses Alltagsdrama hätte in einem Review wenigstens das Lob „Realistische Darstellung“ bekommen.
Oft steht er an der Tür und verabschiedet die Fahrgäste, dabei stellt er sich vor, wie es wäre. Wie es wäre, ebenfalls den Schritt über die Schwelle zu wagen. Dem Statistendasein zu entsagen.
Ein Protagonist sein und seinen eigenen Weg bestimmen, wohin ihn seine Füße an diesem Tag lenken. An einem unbekannten Ort zuhause sein und sich in jede zwischenmenschliche Begegnung frisch verlieben.
„Tschüss, auf Wiedersehen, schön, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben“, sagt er stattdessen wieder und wieder, bis er Fuseln auf der Zunge spürt.
Wieder und wieder, Tag für Tag, Ausstieg für Ausstieg. Ein ewiger Teufelskreis.
Es ist nur ein Schritt, und jedes Mal verpasst er die Zeit zum Absprung.
Eine viel zu große Regelmäßigkeit. Ist es, weil er den Zug nicht verlassen kann, weil er an ihn gebunden ist?
Er hat den Zug und er hat die Klagen.
Würde er jemals in eine Talkshow eingeladen werden, genau darüber könnte er sprechen. Zu stressig, die Gäste sind zu undankbar und der Zug seine Heimat.
„Und wenn Sie nun einfach aussteigen und… den Job wechseln?“, könnte der Moderator fragen, es würde Schweigen folgen.
„Es gehört zu mir.“
„Wie meinen Sie das? Das Zugfahren oder die ständigen Beschwerden?“
„Beides.“
Klagen sind wie rote Fahnen, man kann sie schwenken und hat für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit aller Umstehenden. Dann muss der Statist seinem ziellosen Streben nachgehen, damit die Protagonisten ihn miteinbeziehen können, miteinbeziehen in das Wort „Zugfahren.“
Fast ist er glücklich, dass er kein auffälliger Statist sein kann, da ihm dieses Merkmal laut der modernen Dramenstruktur nicht zu Grunde liegt. Umgekehrter Egoismus ist ihm nicht verboten, er darf die Klagen und die eigene Unvollkommenheit auf eine schmerzhafte Weise lieben.
Er ist nicht unsichtbar, aber schwer erkennbar, er beklagt sich immer wieder, hört gar nicht mehr auf damit und wird dennoch nicht erhört. Eine konstante Parallele zu den Interessen seiner Vorgesetzten, vielleicht gegenläufig, das mag sein, aber es wird niemals einen Schnittpunkt geben.

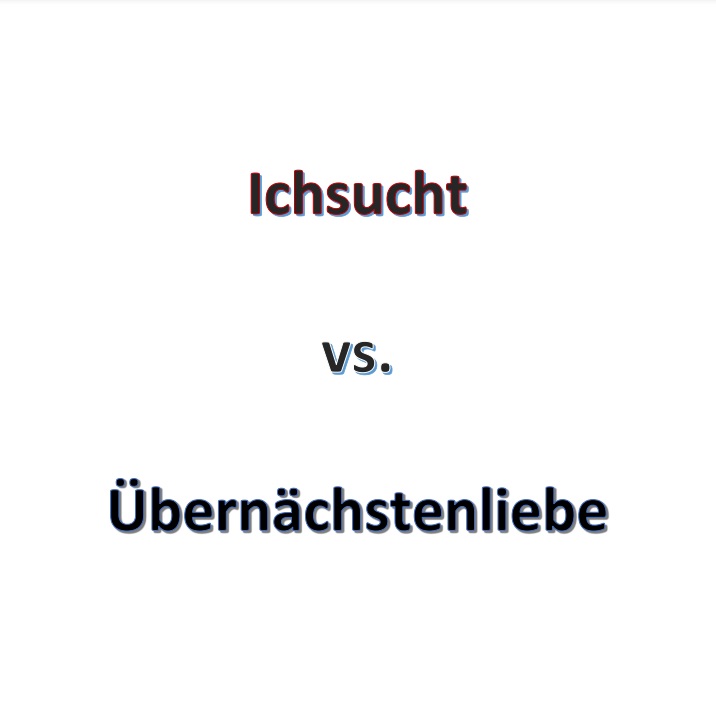
One thought on “Protagonistenblicke”