Selbstaufgabe
von Sam Grünfink
Sie saß auf der harten Sofakante und starrte die Tabletten an. Es waren genug, das wusste sie. Ihr Herz klopfte. Aber war es auch der richtige Moment? Der Kleine ihrer Schwester lernte gerade Schwimmen.
Es war nie der richtige Moment.
Aber es war auch nicht zu leugnen, dass sie anderen eine Bürde war. Sie mussten ihr helfen, sich um sie kümmern, mit ihr einkaufen, für sie kochen, ihr auch sonst im Haushalt helfen. Ihre Mutter, ihre Schwester, die eigentlich andere Sorgen und eigene Familien hatten. Sie dachte wehmütig an ihre Familie, es waren wunderbare Menschen.
Da war ihre Mutter, eine ausgemergelte, aber zähe Frau, die sich nach dem frühen Tod ihres Ehemannes mit der kläglichen Rente durchs Leben schlagen musste. Und sie war dennoch so herzlich, so gütig und weich. Ihre Mutter war der empathischste Mensch, den sie kannte. Sie gab alles weg, was sie besaß. Sie gönnte ihren Mitmenschen jedes schöne Ereignis. Und sie schob ihr hier und da einen Schein zu, für die teuren Medikamente, die die Krankenkasse nicht zahlen wollte, und das, obwohl sie das Geld selbst bitternötig hatte.
Da war ihre Schwester, die fast zerrissen wurde zwischen ihren kleinen Kindern, dem Job und nun eben ihr. Die zwar einen liebevollen Mann hatte, der beruflich jedoch viel in der ganzen Welt unterwegs war. Ihre Schwester war fürsorglich, eine richtige große Schwester und eine Bilderbuchmutter, trotz ihres Teilzeitjobs, bei dem oft mehr von ihr verlangt wurde, als sie geben konnte. Trotzdem schaffte sie den Spagat und sie schaffte ihn mit einem Lächeln.
Da waren die Kinder, ihre Nichten und ihr Neffe, quirlige Energiebündel, die alles Erdenkliche wissen wollten und die einen regelrecht ausquetschten.
Sie blickte wieder auf die Tabletten, die sie vor sich auf dem niedrigen Wohnzimmertisch ausgebreitet hatte, ließ ihren Blick weiterwandern zu der Fotographie ihres Vaters, eines ernsthaften, kleinen Mannes mit Schnurrbart, der abends seine kleinen Töchter zur Begrüßung durch die Luft gewirbelt hatte, bis allen schwindelig war. Sie hatte eine schöne Kindheit gehabt.
Das hatte sie auch mit ihren Nichten und Neffen so machen wollen, das ging jetzt nicht mehr. Voller Abscheu betrachtete sie ihre linke Hand.
Ihre linke Hand schien nicht mehr zu ihrem Körper zu gehören. Sie hing wie ein lebloses Anhängsel an ihrer Seite. Die Schwellung der Gliedmaße hatte wieder abgenommen, aber sie war noch sehr verfärbt und schmerzte bei jeder Berührung. Und sie schmerzte auch ohne Berührung, die Schmerzattacken kamen und gingen, wie sie Lust und Laune hatten. Da war ein Brennen, das sich nie ganz abstellen ließ, und das manchmal aufwuchs zu einem Gefühl, als würde man eine offene Wunde desinfizieren. Dauerhaft. Ohne Erbarmen. Dann kamen zusätzlich Dolchstöße in ihre Hand, insbesondere in das Handgelenk. Ein Stechen, das ihr den Atem nahm. Die Hand war nutzlos geworden.
Wieder starrte sie die Tabletten an.
Anderswo passierten Massaker, starben unzählige unschuldige Kinder, und sie saß hier und wollte…
War sie undankbar? Nein, sie hatte ihr Leben nur bereits gelebt. Es war ihre Entscheidung! Sie dachte an ihre Unbeschwertheit, die sich nach dem Unfall langsam, aber sicher in Luft aufgelöst hatte. Das war jetzt fünf Jahre her. Eigentlich hatte ihr Leben an dem Tag geendet, nur dass sie es damals noch nicht begriffen hatte.
Jetzt war alles anders. Hilfsbedürftig. Arbeitsunfähig. Das Gegenteil von einem lebenswerten Leben, dachte sie.
Mit jedem Jahr verkümmerte die Hoffnung auf Heilung weiter. Nun war sie gestorben. Sie hatte sie begraben, unter der Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Und das konnte sie ihrer Familie nicht antun. Sie waren besser dran ohne sie.
Es tat weh, aber es tat noch mehr weh, ihre eigene Familie so zu belasten. Sie musste die Menschen, die sie liebte, von sich befreien.
Sie hatte sich aufgegeben. Langsam drückte sie eine Tablette nach der anderen aus der Packung. Die Blisterpackungen sammelte sie, wollte sie noch in den Müll werfen. Wenn sie schon nicht gesund werden konnte, konnte sie das wenigstens tun. Den Müll wegwerfen, inklusive sich selbst. War sie nicht auch zu so etwas geworden?
Sie griff nach der ersten Tablette, die an ihrer schwitzigen Hand festklebte.
War es richtig? Sie wusste auf einmal nicht, wie der Gesichtsausdruck ihrer Mutter sein würde. Erleichterung würde sie wohl kaum ausdrücken. Aber es würde besser für sie sein, wenn sie sich nicht um ihre behinderte Tochter kümmern müsste.
Während sie einige Tabletten mit einem Schluck Wasser die trockene Kehle hinabspülte, wanderten ihre Gedanken weiter. Sie würde nicht an der Einschulung teilnehmen können. Nie mehr da sein, nie mehr auf sie aufpassen.
Das war auch ok für sie, unter diesen Umständen wollte sie nicht leben. Es war die völlige Selbstaufgabe. Wenn sie schon nichts mehr wert war.
Dabei gab sie sich ja nicht auf, sie hatte sich schon vor langer Zeit aufgegeben. Was sie tat, das war nur ihrer Familie zu helfen. Wenn die erstmal die erste Zeit überstanden hatten, würden sie sich freuen.
Die Hälfte der Tabletten lag noch auf dem spiegelnden Glas des Wohnzimmertischs. Auf einmal dachte sie daran, wie ihre Beerdigung wohl sein würde. Ihre kleine Familie ganz in Schwarz gekleidet und dazwischen die Kinder, die nichts verstanden.
Sie erinnerte sich an die Beerdigung ihres Vaters und daran, dass ihre Mutter sich nie ganz davon erholt hatte. Wollte sie das? Konnte sie das wollen? Konnte sie ihr das ein weiteres Mal zumuten? Es lag doch in ihrer Hand. All die festgeschmiedeten Gedanken schienen sich plötzlich aufzulösen, schienen wegzutreiben, ohne dass sie sie zu fassen bekam.
War es nicht doch purer Egoismus?
Nur, wenn sie die völlige Bestätigung ihrer Mitmenschen hatte, konnte sie sich spüren. Nur, wenn sie alle Erwartungen übertraf, fühlte sie sich gesehen, angenommen. Als hätte sie nur dann ein Recht auf das Leben. Ihr Leben.
Und das war gerade nicht so, sie besaß folglich keinen Wert mehr. Ging es nicht eher darum?
Vor ihrem inneren Auge sah sie die gebückte Gestalt ihrer Mutter unter dem Gewicht schwanken. Wollte sie sie denn zu Fall bringen? Sie wollte genau das Gegenteil. Sie wollte sie doch entlasten.
Sie spürte die nächsten Tabletten in ihrer Hand plötzlich wie Bleikugeln. Es war schwer zu ertragen, dass sie in jedem Fall ihrer Mutter eine Last sein würde. Sie musste sich entscheiden. Pest oder Cholera. Was in diesem Fall besser war, wusste sie auch nicht. Wenn sie weiterlebte, würde ihre Mutter vielleicht nicht zusammenbrechen, ihre Schwester nicht den Kindern erklären müssen, was der Tod war und dass ihre Tante nie mehr wieder auf sie aufpassen würde.
Sie hätte immer noch die Möglichkeit, beide Wege zu gehen. Wenn es gar nicht mehr ging.
Ihr war übel und schwindelig. Sollte sie den Notarzt rufen?

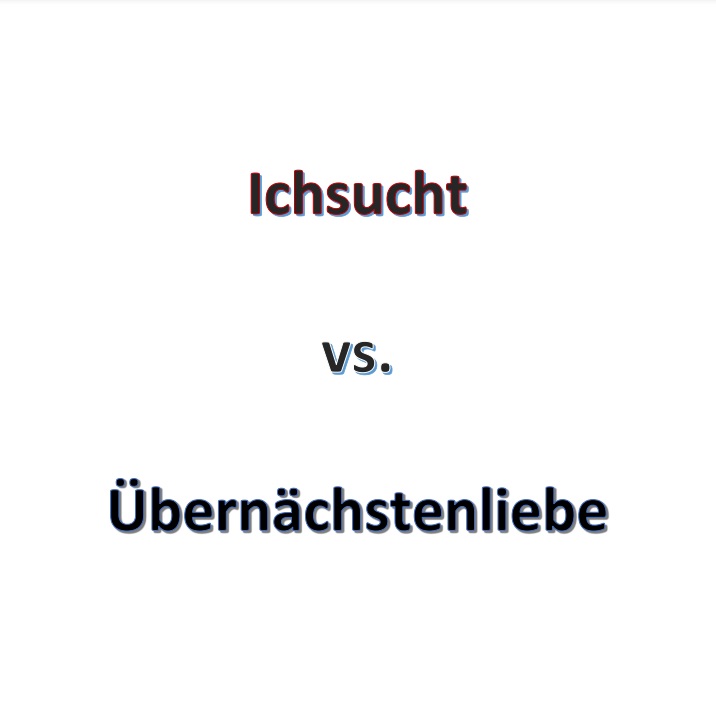
One thought on “Selbstaufgabe”