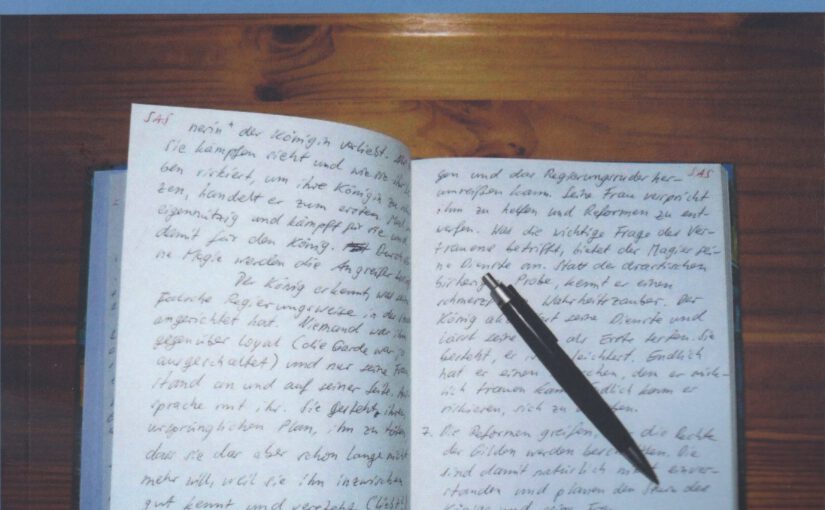Von der Kunst des Prosaschreibens – 10. Show, don’t tell! -Teil 1
Warum gutes Beschreiben so wichtig ist: Teil 1: Grundlagen
Liest man ein beliebiges Buch, das, sagen wir, ungefähr vierzig oder fünfzig Jahre alt ist (manchmal auch noch ein bisschen jünger), begegnen wir dem „auktorialen Erzählstil“. „Auktorial“ = durch die Autorinnen/Autoren. Kennzeichen dieses Stils ist, dass eine „Stimme aus dem Off“ den Lesenden mehr oder weniger nüchtern erzählt, was in einer Szene passiert, vergleichbar mit der Tonspur für Sehbehinderte im Fernsehen:
Nico ging die menschenleere Straße entlang. Vor dem Haus Nummer 17 blieb er stehen und blickte an der Fassade hoch. Er schüttelt den Kopf und ging weiter.
Aber man erfährt nicht, warum Nico sich in der Straße befindet, welchen Grund er hat, vor gerade diesem Haus stehenzubleiben und an ihm hoch zu sehen, was er dabei sieht und warum er den Kopf schüttelt. Erst recht erfährt man nicht, was er dabei denkt oder fühlt. Um Sehbehinderten den Handlungsablauf zu erklären, genügt das – aber nicht für einen Roman.
Die auktoriale Perspektive wird heute von den meisten Lesenden und nahezu allen Verlagen abgelehnt. Der Grund: Unsere Aufgabe als Autorinnen/Autoren ist, den Lesenden mit Worten Bilder zu malen, die sie in ihrem Kopf, vor dem „geistigen Auge“, sehen können, in ihnen ein „Bild“ nicht nur eines Schauplatzes oder Geschehens, sondern auch von den Gefühlen der Figuren zu erzeugen. Wir müssen die Dinge so beschreiben, dass die Lesenden den Duft auf dem Marktplatz, auf dem unsere Figur einkauft, riechen, die salzige Seeluft oder den Wein auf der Zunge schmecken, den Schmerz und die Freude unserer Figuren, die Hitze oder Kälte auf ihrer Haut spüren und von dem Menschen, den unsere Figur verfolgt, ein so lebendiges Bild „sehen“ können, als stünde er direkt vor uns. Darum spricht man auch davon, das „Kopfkino“ anzukurbeln.
Ohne solchen „erlebbaren“ Beschreibungen können die Lesenden nicht oder nur schwer in das Geschehen, in die Geschichte eintauchen und sich erst recht nicht mit den Figuren identifizieren, weil sie nicht „in ihnen stecken“. Dass sie das aber können, ist nicht nur eine Voraussetzung dafür, dass sie dadurch gut unterhalten werden und die von uns erfundenen Figuren als reale, lebendige Wesen wahrnehmen (diese Illusion müssen wir für sie erschaffen können), sondern auch für die Spannungserzeugung.
Rob öffnete leise die Zimmertür, schlich zur Haustür und war froh, dass niemand ihn bemerkte. Die Tür war abgeschlossen, kein Schlüssel steckte. Mist! Aber das Fenster im Badezimmer bot eine gute Fluchtmöglichkeit.
Wie langweilig! Das, was sie Szene spannend macht – Robs Gefühle, Befürchtungen, das Bewusstsein der Gefahr, in der er sich befindet, vielleicht auch seine Verzweiflung – all diese Informationen fehlen. Machen wir daraus eine spannende Beschreibung:
Zentimeter um Zentimeter öffnete Rob die Zimmertür und hielt den Atem an. Jeden Moment rechnete er damit, dass sie in den Angeln quietschte und ihn verriet. Er atmete erst aus, als er sie weit genug aufgeschoben hatte, um sich durch den Spalt zu zwängen. Bevor er auf den Flur trat, vergewisserte er sich, dass der leer war. Leise schloss er die Tür hinter sich. Das kostete ihn zwar wertvolle Sekunden, aber falls jemand durch den Flur ging, musste derjenige nicht schon durch die offene Tür auf Robs Flucht aufmerksam werden.
Er lauschte. Im Wohnzimmer lief der Fernseher. Hoffentlich saßen alle seine Bewacher dort, und hoffentlich musste nicht ausgerechnet in dem Moment einer von ihnen zur Toilette, wenn Rob vorbei schlich. Auf Zehenspitzen ging er so schnell er es halbwegs geräuschlos schaffte, zur Vordertür und dankte Gott, dass niemand ihn bemerkt hatte. Er drückte die Klinke herunter. Abgeschlossen. Und leider steckte kein Schlüssel im Schloss. Mist! Seine Flucht durfte doch nicht hier schon scheitern! Panik kroch in ihm hoch. Was nun? Bleib cool, ermahnte er sich, noch ist nichts verloren.
Er unterdrückte die aufkeimende Verzweiflung und sah sich um. Die Fensterbänke waren dicht an dicht mit Blumentöpfen vollgestellt, die er erst hätte abräumen müssen, um durch eins zu entkommen. Er bezweifelte, dass das geräuschlos ginge. Außerdem hielte ihn das zu lange auf. Verdammt! Es MUSSTE doch eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen! – Das Fenster im Bad! Das war unverstellt und groß genug, dass er sich hindurchzwängen konnte. Er schlich zum Badezimmer, schlüpfte hinein und verriegelte die Tür.
Und wir halten zusammen mit Rob die Luft an und hoffen wie er, dass seine Flucht gelingt. Weil wir durch die Beschreibung dessen, was er sieht und vor allem fühlt, „durch seine Augen“ das Geschehen erleben.
Diesen Effekt erreicht man aber nur, wenn man a) die Handlung aus der Perspektive einer beteiligten (oder zuschauenden) Person schildert (personale Perspektive), sie durch deren „Augen“ betrachtet, und b) die Beschreibungen so gestaltet, dass bei den Lesenden ein lebendiges Bild im Geist entsteht. Die gerade, aber nicht nur bei Neulingen beliebten Adjektivketten erfüllen diesen Zweck nicht. Der Grund: Das Adjektiv ist ein EIGENSCHAFTSwort, d. h. es benennt eine Eigenschaft (groß, klein, grün, kahl, bunt, blond, rot, kalt usw.), aber das Aufzählen von Eigenschaften ist keine Beschreibung, weil Eigenschaften viel zu ungenau sind, um ein konkretes Bild zu „malen“.
Der Mann trug abgewetzte braune Stiefel, in denen die Beine seiner blauen Hose steckten. Das grüne Hemd war in den Hosenbund geschoben. Darüber trug er einen schwarzen Mantel.
Beginnen wir bei den Farben. Alle genannten haben zig Nuancen von hell bis dunkel und ebenfalls zig mögliche Töne. „Braun“ könnte schwarzbraun, ockerfarben, terrakottafarben, sandfarben, rotbraun, goldbraun, olivbraun und etliches mehr bedeuten. Für Blau und Grün gibt es ebenso viele Varianten. Auch der Mantel ergibt kein konkretes Bild. Was für ein Mantel? Sommermantel, Wintermantel, bis zu den Waden reichend oder nur bis zu den Oberschenkeln oder Knien? Aus Wolle, Leinen, Filz, Kunststoff? Mit Reißverschluss, Knöpfen, Druckknöpfen? Mit zig Außentaschen oder taschenlos? Langärmelig oder kurze Ärmel, mit oder ohne Kapuze?
Für Kurzgeschichten, deren Würze in der Kürze liegt, kann und sollte man auf alle Beschreibungen verzichten, die nicht durch den Handlungsablauf erforderlich sind. Gerade in Kurzgeschichten ist in den seltensten Fällen notwendig, eine Person oder Umgebung detailliert zu beschreiben. In Storys genügen, wenn z. B. das Nennen der Kleidung erforderlich ist, die obigen auktorialen Aufzählungen vollkommen. Aber in einem Roman gelten andere Anforderungen. Dort ist sind „Wortgemälde“ bis auf wenige Ausnahmen (zu denen wir in einer späteren Folge kommen) Pflicht.
Bevor wir (in den nächsten Folgen) zu der Kunst kommen, WIE wir diese Wortbilder möglichst vorteilhaft malen können, gehen wir erst einmal der Frage auf den Grund, warum es besonders Neulingen so schwerfällt, sich vom auktorialen „Aufsatzstil“ zu lösen und auch Profis hin und wieder in die „Erzählfalle“ tappen. Schuld daran ist die „Macht der Gewohnheit“. Sehen wir uns unsere ganz normale alltägliche Kommunikation genau an. Wir erzählen (!) in der Ich-Perspektive und wir berichten auktorial, wenn wir über jemand/etwas anderes erzählen als uns selbst. Hatten wir eine angstmachende Begegnung mit Nachbars Schäferhund und erzählen davon im Freundeskreis, sagen wir: „Mensch, da hatte ich aber eine Scheißangst!“ Wir kämen nie auf den Gedanken, in bester Beschreibungsmanier nach „Show, don’t tell!“ detailliert auszumalen, wie sich die Angst angefühlt hat, was genau wir dabei empfunden haben, dass unser Herz raste, uns der Schweiß ausbrach etc. (Einzige Ausnahme: Wenn wir im Rahmen einer Psychotherapie konkreter unsere Gefühle beschreiben müssen/wollen.)
Berichten wir dem besten Freund/der besten Freundin von dem tollen Menschen, dem wir gestern begegnet sind und in den wir uns Knall auf Fall verliebt haben, beschreiben wir NICHT in bester „Wortbild“-Manier: „Die Haare leuchten wie ein reifes Weizenfeld, und die Augen erinnern mich an das Meer in der Sommersonne. Und dieser ansprechende Kontrast der schwarzen Jacke zum blutroten Hemd weckte in mir den Wunsch, ihr/ihm das auf der Stelle auszuziehen.“ Nein, so reden wir nicht, wenn wir uns nicht lächerlich machen wollen. Wir erzählen auf die Frage, wie die Person denn ausgesehen hat: „Blonde Haare, blaue Augen, und die schwarze Jacke zum roten Hemd fand ich total sexy.“
Und das ist der gravierende Unterschied zwischen unserer normalen Alltagssprache, die wir auch in unseren Schulaufsätzen geschrieben haben (und die wir unsere Figuren in deren wörtlicher Rede sagen lassen können/dürfen), und der literarischen Ausdrucksweise. Die Tücke: Weil wir, seit wir zu sprechen gelernt haben, unser gesamtes Leben lang auf diese Weise kommunizieren, fällt uns zunächst wahnsinnig schwer, von dieser Gewohnheit, die für uns normal ist, abzuweichen und auf „Beschreibung“ umzudenken. Hier hilft wirklich nur Übung, Übung, Übung und noch mehr Übung, bis wir „im Schlaf“ in der Sekunde, wenn wir uns an den PC setzen, um eine Geschichte, einen Roman zu schreiben, von „Alltagssprache“ auf „Literatursprache“ umschalten können.
Wie alle neu zu lernenden Dinge braucht das seine Zeit. Bis diese Zeit vergangen ist, werden wir zwischendurch immer wieder in die jahrzehntelange Gewohnheit der Alltagserzählsprache zurückfallen. Das ist ganz normal! Im Lauf der zunehmenden Schreiberfahrung gewöhnt man sich aber an die literarische Ausdrucksweise. Und was uns in diesem Punkt entgeht, entdeckt garantiert später das Lektorat.
In der nächsten Folge: So wird’s gemacht – wie gutes Beschreiben funktioniert