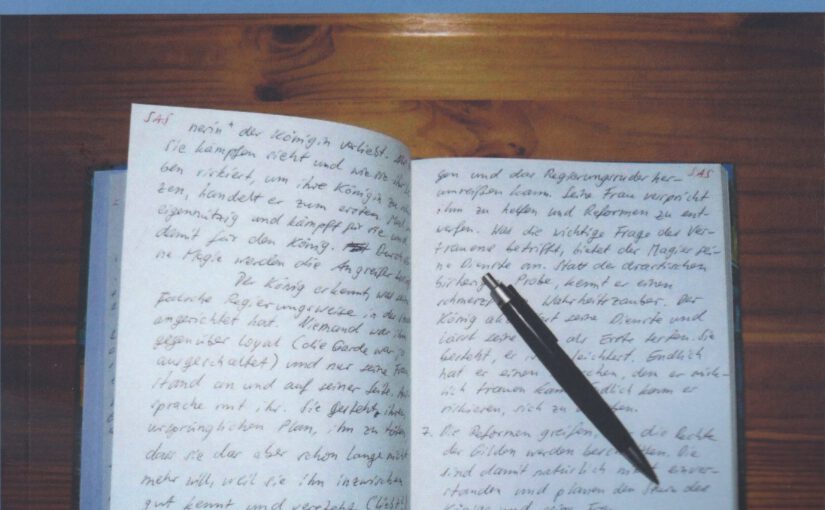Von der Kunst des Prosaschreibens – 11. Show, don’t tell! – Teil 2
Show, don’t tell! – Teil 2: So wird’s gemacht
Grundsätzlich gilt: Beschreibungen sollten immer nur an den Stellen stehen, wo sie für die Szene erforderlich sind, weil sie:
- Informationen zur Umgebungen liefern, die an dieser Stelle für die unmittelbar folgende(n) Handlung(en) notwendig sind, sodass die Lesenden sich das Setting bildhaft vorstellen können, ohne das sie das Folgende nicht verstehen würden/nachvollziehen könnten.
- wichtige Hinweise auf eine künftige Szene liefern, die, um die Lesenden nicht „vorzuwarnen“, nicht unmittelbar vor der Stelle platziert werden sollten, für die sie relevant sind.
- genretypisches Lokalkolorit für Regionalliteratur liefern.
- Charaktereigenschaften oder Äußerlichkeiten von Figuren darstellen, die die Lesenden jetzt oder als an dieser Stelle wichtige Vorbereitung zum Verständnis der folgenden Handlung benötigen oder
- die für/in diese/r Szene wichtigen akuten Gefühle einer Person aufzeigen.
„Benötigt“ man eine Beschreibung für diese Zwecke nicht, kann und sollte man darauf verzichten.
Die beste Technik des Beschreibens besteht darin, das, was wir den Lesenden vermitteln wollen, nicht nur als eine Art Nacherzählung aufzulisten, sondern in eine Handlung einzubetten.
Beispiel:
„Der Mann hatte schneeweiße Haare und blasse Augen. Er trug einen grauen, viel zu großen, schäbigen Mantel, darunter einen ausgebeulten Jogginganzug.“
Diese Passage könnte von einer Filmtonspur für Sehbehinderte stammen oder aus einem Polizeibericht (dort kann sie als Täterbeschreibung problemlos so geschrieben werden). Zwar erzählt sie uns, die wir den Mann nicht mit eigenen Augen sehen können, wie er aussieht, aber ein lebendiges Bild von ihm will in unseren Köpfen nicht entstehen. Außerdem haben wir sein Aussehen ein paar Absätze später wieder vergessen, sofern nicht zwischendurch immer wieder darauf Bezug genommen wird. Formulieren wir die Aufzählung um und erwecken den Mann zum Leben, indem wir ihn durch die Augen der Figur ansehen, aus deren Perspektive wir gerade schreiben.
Sina bog um die Ecke und blieb abrupt stehen. Fast wäre sie mit einem Mann zusammengestoßen, der dort schon eine Weile gestanden haben musste. Als Erstes fiel ihr sein weißes Haar auf, das von seinem gebräunten Gesicht ebenso scharf abstach wie die wasserhellen Augen, mit denen er sie anstarrte.
Sie versuchte an ihm vorbeizugehen. Er vertrat ihr den Weg. Dabei schlotterte sein mausfarbener Mantel derart um seinen Körper, als hätte er einmal einem erheblich korpulenteren Menschen gehört. Dem muffig-säuerlichen Geruch nach zu urteilen, den er bei dieser Bewegung ausströmte, war er seit einer Ewigkeit nicht gewaschen worden. Auch der Jogginganzug darunter hatte schon bessere Tage gesehen. Die Farbe war bis zur Unkenntlichkeit verblasst, und die Kniebeulen hingen tief. Noch immer starrte der Mann sie an.
Nach dieser Beschreibung kann man den Mann nicht nur vor sich sehen, sondern hat auch seinen Geruch in der Nase. Warum? Weil der Text den Mann in einer aktiven Szene mit Sina interagieren lässt: Er vertritt ihr den Weg, starrt sie an, sie versucht auszuweichen. Dadurch spricht der Text nicht nur unsere (inneren) Augen, sondern auch andere Sinne an. Genau das macht einen Text lebendig. Jedoch: Auch in dieser Form sollte man auf eine so geballte Beschreibung wie in diesem Beispiel verzichten, sofern sie nicht an dieser Stelle für die aktuelle Handlung oder grundsätzlich relevant ist. Solche Beschreibungen wirken schnell überfrachtet. Man kann die Figuren, sogar die Hauptfiguren, häppchenweise über den ganzen Roman verteilt beschreiben oder die Beschreibung sogar ganz weglassen. Ja, weglassen, denn manche Lesende ziehen es vor, die Hauptfiguren in ihrer Fantasie entstehen zu lassen und wollen deshalb keine von uns vorgegebene Beschreibung oder ihr „Porträt“ auf dem Titelbild. Aber dies ist einer der Punkte, bei dem man es nicht allen recht machen kann.
Wichtig ist auch, dass die Handlung die Beschreibung bedingt. Bei der obigen Szene wird der müffelnde Geruch erst durch die Handlung (hier das Schlottern des Mantels um den Körper) möglich. Wenn der Mann völlig stillgestanden hätte, hätte der Mantel sich nicht bewegt und (vermutlich) keinen Geruch ausgeströmt, den Sina hätte wahrnehmen können. Das Augenmerk der Betrachtenden kann auch durch die Handlung auf das zu beschreibende Detail gelenkt werden:
John packte seinen Gegner am Arm, bekam aber nur den Hemdärmel zu fassen. Der Mann warf sich zurück. Der Ärmel riss auf und entblößte eine Narbe, die vom Handgelenk bis zum Ellenbogen reichte.
Ohne die Prügelei, in deren Verlauf der Hemdärmel zerrissen ist, wäre die Narbe verdeckt geblieben und John hätte sie nicht gesehen.
So werden Handlung und Beschreibung folgerichtig (und spannend) verknüpft und auf diese Weise wird eine Beschreibung oder werden mehrere Beschreibungen in einen Handlungsrahmen eingebettet.
Eine weitere Möglichkeit, Personen (oder Gegenstände) zu beschreiben, besteht darin, ihre Beschreibung in einen Dialog einzubetten und/oder das Aussehen in die Handlungen zu integrieren, die den Dialog begleiten.
Sie musterte ihn kritisch. „Also, so hässlich ist dein Gesicht nun wirklich nicht, dass du es hinter einem Bart verstecken musst.“
Schon wissen die Lesenden, dass der Angesprochene einen Vollbart trägt, andernfalls er sein Gesicht nicht dahinter „verstecken“ könnte.
„Deiner Figur nach zu urteilen treibst du wohl Sport?“, vermutete Simon.
Rob nickte. „Basketball.“
„Ich dachte immer, dass man dafür mindestens einsneunzig, am besten zwei Meter groß sein muss. Du bist doch“, Simon musterte ihn abschätzend, „höchstens – einsachtzig?“
„Einsfünfundsiebzig. Aber was mir an Größe fehlt, mache ich durch Schnelligkeit und Treffgenauigkeit wett.“
Hier erfährt man gleich mehrere Dinge über Robs Aussehen. 1. Er hat einen muskulösen Körper, sonst würde Simon nicht von seiner Figur auf eine sportliche Betätigung schließen. Robs Antwort bestätigt das. 2. Er ist einen Meter fünfundsiebzig groß. 3. Wir erfahren außerdem über ihn: Er ist schnell und kann treffsicher werfen. Mit Sicherheit wird diese Information im Laufe der Gesichte/des Romans noch eine wichtige Rolle spielen, andernfalls sie überflüssig wäre.
„Ich wünschte, ich hätte auch so einen klangvollen Namen. Deiner hat bestimmt eine nette Bedeutung.“
„Ruari heißt ‚der Rote’. Den Namen hat man mir wegen meiner Haarfarbe verpasst.“
Womit wir „nebenbei“ erfahren, dass Ruari rote Haare hat.
Gerd musterte das Bild mit hochgezogenen Augenbrauen. „Ich weiß nicht, aber das soll Kunst sein? Das sind doch einfach nur schachbrettförmig angeordnete farbige Flächen. Also, wenn das Kunst ist – das kann ich auch.“
Und die Lesenden wissen nun ebenfalls, wie das Bild in etwa aussieht.
Ein paar Beispiele, wo das Aussehen den Dialog begleitet:
„Wohin führst du mich heute Abend aus?“, erkundigte sie sich, während sie vor dem Spiegel den Sitz ihrer blonden Lockenpracht überprüfte.
Damit wissen die Lesenden, dass die Sprecherin blond ist und ihre Haare lang und lockig sind.
„Du bist ein Idiot!“, fauchte sie ihn an. Ihre Augen blitzten wütend.
Ihm fiel zum ersten Mal auf, dass sie die Farbe von dunklem Bernstein besaßen.
Und wir wissen das jetzt auch.
„Ich habe doch gleich gesagt, dass wir DORT langgehen müssen.“ Er wies mit ausgestrecktem Arm nach Norden. Dabei rutschte sein Ärmel hoch und entblößte das Tattoo eines grimmig dreinblickenden Drachen auf seinem Unterarm.
Solche Beschreibungen sind nur für Romane und eventuell noch Novellen und Erzählungen erforderlich. Bei Kurzgeschichten liegt die Würze in ihrer Kürze. Man sollte deshalb darin auf Beschreibungen aller Art verzichten, sofern sie nicht zum Verständnis der Geschichte wichtig sind oder einen Kernpunkt darstellen.
Das gilt grundsätzlich auch für unsere Romanfiguren. Allerdings gehen hier die Vorlieben der Lesenden, wie schon gesagt, und auch der Lektorierenden auseinander. Manche wünschen detaillierte Beschreibungen des Aussehens, um sich die Figuren plastisch vorstellen zu können. Andere ziehen es vor, das ihrer Fantasie zu überlassen und möchten am liebsten gar keine Beschreibung, damit ihre eigene Vorstellung nicht durch sie zerstört wird.
Beschreiben wir von unseren Figuren nur, was nötig ist oder was wir für wichtig halten, und überlassen wir den Rest der Fantasie der Lesenden. Es sei denn, der Verlag wünscht es anders.
Wir sollten bei unseren Schilderungen nach Möglichkeit alle Sinne der Lesenden ansprechen Der Mensch hat sechs davon: Er sieht, hört, riecht, schmeckt, fühlt und nimmt metaphysisch wahr (zum Beispiel wenn wir, ohne jemanden zu sehen, trotzdem wissen, dass jemand uns beobachtet). Reizen wir diese Sinne!
„Er saß am Lagerfeuer und dachte nach“, ist für einen Roman ein platter, nichtssagender Satz, kann aber in einer Kurzgeschichte verwendet werden. Teilen wir den Lesenden (im Roman) nicht nur mit, dass da ein Lagerfeuer ist, sondern lassen wir es sie sehen (klein, groß, Farbe der Flammen), hören (es knistert und knackt), riechen (es duftet nach dem Harz des Holzes, das verbrennt), schmecken (den typischen Geschmack von Rauch auf der Zunge beim Einatmen), fühlen (seine Wärme) und metaphysisch spüren (in diesem Fall die Behaglichkeit, die es vermittelt). Natürlich tun wir das so ausführlich nur, wenn es den Erzählfluss nicht hemmt. Ansonsten genügt es, die wichtigsten Eindrücke zu verarbeiten, die ein Lagerfeuer vermittelt.
„Tom setzte sich nahe ans Feuer, um möglichst viel von dessen Wärme in sich aufzunehmen, und beobachtete eine Weile, wie die Flammen gierig an den Zweigen leckten. Ein intensiver, beinahe betörender Duft nach Harz stieg davon auf, und das Knistern des brennenden Holzes klang, als wollte es ihm etwas zuflüstern. Er entspannte sich und sah zu, wie die Glut die Äste fraß, während seine Gedanken abschweiften.“
Dieser Text spricht nicht nur unsere Sinne an, sondern lässt das Feuer beinahe wie ein lebendiges Wesen erscheinen, das gierig leckt, flüstert und mit Duft betört.
Beschreiben wir Dinge, Situationen, Personen etc. so anschaulich wie möglich. Sprechen wir die Sinne der Lesenden an. Vor allem: Versetzen wir uns während des Schreibens in die Szene hinein, die wir beschreiben wollen und sehen uns darin um, als würden wir einen Film ansehen oder ein Bild betrachten. Was sehen wir, fühlen wir? Eben das beschreiben wi anschließend in möglichst flüssigen, einprägsamen Sätzen.
Ein Hinweis, dass wir (wieder) in den „Erzählmodus“ verfallen, sind die Hilfsverben „sein“ (ist/sind oder war/waren) und „haben“ (hat/hatte). „Er hatte blaue Augen, blonde Haare und sonnengebräunte Haut.“ Oder: „Seine Augen waren blau, die Haare blond und seine Haut sonnengebräunt.“ Oder: „Livia stellte fest, dass seine Augen blau waren, die Haare blond und seine Haut sonnengebräunt.“ Oder wenn Livia einer Freundin erzählt: „Gestern bin ich einem tollen Typen begegnet. Er hatte unwahrscheinlich blaue Augen, Haare wie Gold und eine wunderbar gebräunte Haut.“
Auch wenn wir um diese Aufzählung herum eine Beschreibung der Umstände weben und den Mann wie hier durch Livias Augen „ansehen“ oder sie im Dialog ihrer Freundin von ihm berichten lassen, so ist und bleibt diese Form dennoch eine Aufzählung seiner Eigenschaften und keine Beschreibung. (Für wörtliche Rede kann man sie benutzen, denn auch unsere fiktiven Figuren dürfen reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.) Eine lebendige Beschreibung wäre z. B.: „Er blickte Livia aus den blausten Augen an, die sie je gesehen hatte. Der Wind wirbelte sein blondes Haar durcheinander, dessen Farbe einen interessanten Kontrast zu seiner sonnengebräunten Haut bildete.“ Hier sind die Eigenschaften in eine Handlung eingebettet: die blauen Augen blicken Livia an, der Wind spielt mit dem blonden Haar, das wiederum mit der braunen Haut kontrastiert/einen Kontrast bildet. All das sind Handlungen – blicken, spielen, kontrastieren/Kontrast bilden –, auch wenn sie in zwei Fällen nicht von einer Person „getan“ werden. Und alles sind Dinge, die Livia in diesem Moment so sieht und wahrnimmt.
Wir müssen ebenfalls darauf achten, dass die Lesenden unsere Beschreibungen nachvollziehen können. Sprechen wir z. B. von der „Fünfzigerjahre-Einrichtung“ eines Zimmers, einer Wohnung oder lassen wir den Rechtsmediziner im Krimi feststellen, der Tote habe vor seinem Tod noch „exzellentes Essen“ genossen oder nennen wir die Kleidung einer älteren Frau „matronenhaft“, ohne sie konkret zu beschreiben, können sich die Lesenden darunter nichts Konkretes vorstellen.
Bleiben wir bei den genannten Beispielen. Viele, gerade jüngere und „mittelalte“ Leserinnen und Leser haben keine Ahnung (mehr), was die Kennzeichen des Einrichtungsstils sind, den man als „Stil der Fünfzigerjahre“ bezeichnete. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Beurteilung auch vom Geschmack der Betrachtenden abhängt, ist hier eine konkrete Beschreibung der Einrichtung erforderlich. Allerdings genügt zur Verdeutlichung des Stils, ein paar wenige charakteristische Einrichtungsgegenstände als Beispiel zu beschreiben (Plüschhocker, Nierentisch etc., evt. mit dem Zusatz: „wie in/aus den Fünfzigerjahren“).
„Exzellentes Essen“ – was ist damit gemeint? Dass der Betreffende eine reichliche Menge verdrückt hat? Dass er sein Leibgericht gegessen hat? Ein Drei-Gänge-Menü verspeist hat? In einem Nobelrestaurant Sushi-Häppchen gegessen, Austern geschlürft und Champagner getrunken oder das Star-Menü eines Sternekochs gegessen hat? Oder heißt das, dass für das obdachlose Opfer der vor seinem Tod gegessene Hamburger für ihn ein „exzellentes Essen“ war, weil er sich sonst aus Mülltonnen ernährt? Diese unkonkrete „Wischiwaschi-Bezeichnung“ wirft Fragen auf, die irritieren, weil man nicht erkennen kann, was genau gemeint ist. Hier ist eine konkrete Nennung des Gegessenen erforderlich. Ob das dann das Prädikat „exzellent“ erfüllt, dürfen wir getrost der Beurteilung der Lesenden überlassen; oder lassen wir den Rechtsmediziner diesen Schluss in einem Dialog oder seinem Bericht ziehen.
Bei der Bezeichnung des Kleidungsstils sehen wir einmal davon ab, dass „matronenhaft“ im heutigen Sprachgrabrauch grundsätzlich wenig schmeichelhaft ist und despektierlich klingt, auch wenn das vielleicht nicht so gemeint ist. Sehen wir auch davon ab, dass es etliche Lesende gibt, die den Begriff „Matrone“ nicht (mehr) kennen. Und wir lassen auch unberücksichtigt, dass wie bei der Wohnungseinrichtung eine solche Beurteilung Geschmackssache ist. Es bleibt die Frage, wie sich eine „Matrone“ überhaupt (klischeehaft) kleidet. „Matrone“ war ursprünglich die Bezeichnung für die Ehefrau eines römischen Bürgers. „Matronenhafte“ Kleidung – also römische Toga, Tunika, Stola, Palla (ärmelloser Überwurfmantel der römischen Frauen)? Die Germanen bezeichneten ihre Muttergöttinnen als „Matronen“, deren Kennzeichen u. a. ein haubenartiger Kopf Schmuck oder eine entsprechend gelegte Frisur war (siehe Bild unten). Hat die „matronenhaft gekleidete“ Frau etwa einen solchen Hut auf dem Kopf?
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts war die Bedeutung von „Matrone“ in unserem Land eine Würde ausstrahlende ältere Dame, bei der wir voraussetzen dürfen, dass sich diese Würde auch in ihrer Kleidung ausdrückt. Aber wie, verdammt? In jüngerer Zeit verkam die „Matrone“ zu einer dicken, strengen (weiblichen) Spaßbremse, deren Spaßfeindlichkeit sich auch in ihrem Kleidungsstil ausdrückte. Aber wie, zum Teufel, sieht/sah das aus?
Wir sehen anhand dieser Beispiele, dass Gemeinplätze keine Beschreibung liefern. Selbst wenn wir uns unter ähnlichen wie den oben genannten Pauschalbegriffen etwas Konkretes vorstellen können: die Leserinnen und Leser können das nicht zwangsläufig ebenfalls. Beschreiben wir die Dinge also konkret unter Nennung des Aussehens oder der Bestandteile der betreffenden Dinge. Und unter größtmöglicher Vermeidung von Adjektiven und Adverbien.
In der nächsten Folge: Ausnahmen bestätigen die Regel – wann „Show, don’t tell unangebracht ist