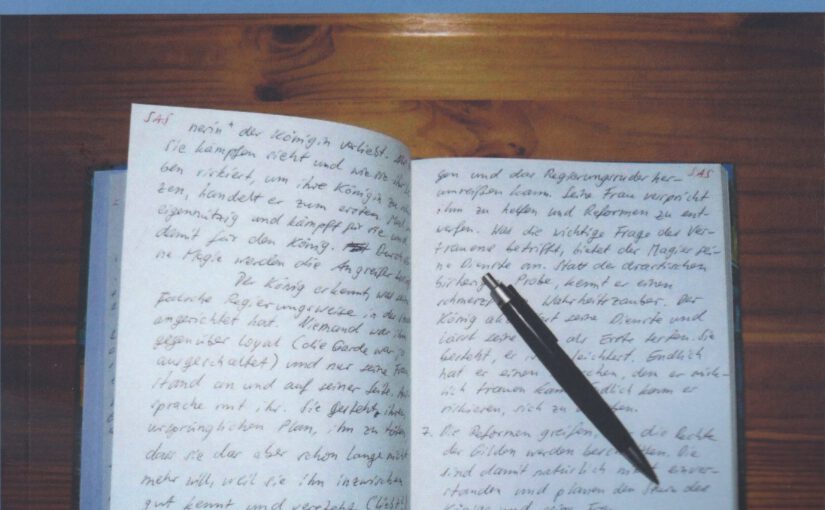Von der Kunst des Prosaschreibens – 15. Show, don’t tell! – Gefühle II Angst
Show, don’t tell : Gefühle beschreiben 2: Angst
von Mara Laue
Noch schwieriger ist das gute Beschreiben von Angst. Ich wage zu behaupten, dass es sogar das am schwierigsten zu beschreibende Gefühl ist. Wir alle haben schon mal Angst gehabt. Doch Angst hat die Eigenschaft, unser Denken zu blockieren, und zwar umso mehr, je intensiver = stärker sie ist. Manchmal sogar so sehr, dass uns Teile unserer Erinnerung an die angstmachende Situation hinterher komplett fehlen (Blackout). Doch selbst wenn wir uns erinnern, wie sich die Angst angefühlt hat, weigert sich unser Gehirn manchmal standhaft, dieses Gefühl nach-FÜHL-bar zu beschreiben.
Der Grund liegt in der Kunst des guten Beschreibens. Klingt paradox, aber: Wenn wir die Angst so gut beschreiben, dass die Lesenden sie nachfühlen können, dann teilen wir diese Empfindung ebenfalls, während wir sie (be)schreiben. Denn wenn wir uns nicht gedanklich und gefühlsmäßig in eine Situation versetzen, in der wir selbst Angst empfunden haben, können wir sie nicht (gut) beschreiben. Und wer will schon gern (nochmals) Angst, vielleicht sogar Todesangst fühlen, und sei es „nur“ in der Erinnerung?
Beim ausschließlichen Lesen entsprechender Passagen verhält es sich anders, denn in dem Fall wissen wir, dass es sich um Fiktion handelt, die „jemand anderes“ erlebt (der/die nicht einmal real existiert, weil es sich um eine Roman-/Storyfigur handelt) und das nichts mit uns zu tun hat. Rührt jedoch etwas Negatives, das wir schreiben (oder lesen, im Film sehen), an unsere eigenen Gefühle, schaltet das Gehirn oft den „Schongang“ ein und verhindert, dass wir das real negative Erlebte allzu genau erinnern. Im Zuge dessen verhindert es aber auch, dass wir es realistisch beschreiben können.
Um das zu vermeiden, greift hier wieder einmal die Beherrschung des Handwerks, mit anderen Worten: die Kenntnis der erforderlichen Technik und in diesem speziellen Fall vor allem die Übung. Je öfter wir, um beim Beispiel der Angst zu bleiben, dieses Gefühl anschaulich beschrieben haben, desto mehr „Vokabeln“ = Formulierungen und beschreibende Sätze beherrschen wir, die wir benutzen, abwandeln, umformulieren können, um uns zu erinnern, wie sie sich real angefühlt hat, und zwar ohne uns immer wieder der Erforschung der eigenen erlebten Angst aussetzen zu müssen, weil wir Alternativformulierungen „auswendig gelernt“ haben und nicht mehr über sie nachdenken müssen. Der Gebrauch von Sätzen wie „Sie hatte wahnsinnige Angst“, „Er hatte Todesangst“, „Die Angst schlug über ihm zusammen“ oder „Panik ergriff von ihr Besitz“ wird dadurch überflüssig.
Nebenbei: Solche Sätze sagen nichts aus. „Wahnsinnig“ ist ein dehnbarer Begriff, der den Lesenden keine Information darüber gibt, wie sich die so klassifizierte Angst äußert oder anfühlt. Und wer selbst noch nie Todesangst verspürt oder eine Panikattacke gehabt hat (was auf die wenigsten Lesenden zutreffen dürfte), kann sich bei selbst der besten Fantasie nicht ausmalen, wie sie sich anfühlt, was sie mit der Person „macht“, die sie empfindet. Deshalb sollten wir es ihnen zeigen:
Justin hatte Dunkelheit schon immer gehasst. Diese undurchdringliche Schwärze, in der sich alle möglichen Gefahren verbergen konnten, die man eben deshalb nicht sah und die einen ohne Vorwarnung anspringen konnten, war für ihn die Mutter allen Grauens. Deshalb ließ er immer das Nachtlicht brennen, wenn er sich schlafen legte.
Doch als er die Augen aufschlug, war es stockfinster im Zimmer. Und etwas hatte Justin geweckt. Hastig tastete er nach dem Schalter der Lampe. Seine Hand zitterte und er zuckte zusammen, als er das kühle Metall des Lampenfußes berührte – eiskalt wie eine Dämonenhand. Die Finger fanden den Schalter, drückten, doch die Lampe versagte den Dienst. War jemand heimlich in sein Schlafzimmer eingedrungen, hatten das Licht sabotiert und lauerte in der Schwärze der Schatten, um …
Hsssss.
Justin fuhr mit einem erstickten Schrei hoch, schlug um sich, um das Ding abzuwehren, das dieses widerliche Zischen in unmittelbarer Nähe ausgestoßen hatte. Gleichzeitig fürchtete er, seine Hände könnten tatsächlich etwas – jemanden treffen. Er wälzte sich aus dem Bett. Atmete hektisch. Als seine Füße den kalten Steinboden berührten, hatte er das Gefühl, die Kälte würde die Sohlen verbrennen. Schmerz durchzuckte seine Beine so heftig, dass ihm übel wurde. Mit fliegenden Fingern tastete er nach dem Griff der Nachttischschublade, rutschte zweimal ab, ehe er ihn fassen und die Schublade aufreißen konnte.
Fieberhaft wühlte er darin, bis er die Taschenlampe fand. Ein eiskalter Schauer lief über seinen Rücken bei dem Gedanken, dass der Unbekannte womöglich schon hinter ihm stand und ihm jeden Moment ein Messer in den Rücken stieß. Er packte die Lampe und riss sie heraus.
Hssssssss!
Das Zischen einer riesigen Schlange erklang so dicht neben ihm, dass er ein Satz rückwärts machte. Die Taschenlampe entglitt seiner schweißnassen Hand. Oh Gott! Wenn nun … Ein heftiges Krachen ließ das Haus erzittern, und die Dunkelheit stürzte sich auf ihn, nahm ihm den Atem und versteinerte seine Lunge. Er japste nach Luft, bekam keine und fühlte seine Beine nachgeben. Er würde sterben. Hier. Jetzt. Und die Dunkelheit würde ihn verschlingen und ihn auslöschen, wenn es ihm nicht gelang, die Tür zu erreichen und ins Licht zu fliehen. Aber seine Beine gehorchten nicht, und die Finsternis drang in ihn ein wie ein Messer.
Hssssssssssssss!
Licht flammte auf, und Justin bekam wieder Luft. Der erste Atemzug schmerzte. Der zweite war mehr ein Schluchzen. Erst der dritten funktionierte halbwegs normal. Das Gefühl von Kälte blieb.
„Alls okay, Justin? Ich hab dich schreien gehört.“
Bobs ruhige Stimme gab ihm einen Anker und vertrieb die in ihn eingedrungene Dunkelheit.
Hssssss.
Das Geräusch, das Justin geweckt hatte. Keine Riesenschlage. Nur der vom Wind bewegte Ast des Apfelbaums, der wie immer über die Hauswand strich. Wieder ertönte das Krachen, gefolgt von grellem Licht. Endlich begriff er. Draußen tobte ein Gewitter. Und das Nachtlicht brannte nicht, weil vermutlich die Birne den Geist aufgegeben hatte. Keine Gefahr, keine Bedrohung. Alles war wie immer. Langsam wich das Gefühl von Beklemmung. Das Zittern blieb und sein polternder Herzschlag beruhigte sich nur langsam.
„Alles okay“, antwortete er seinem Bruder. „Ich hatte nur einen Albtraum und bin aus dem Bett gefallen.“
In diesem Text wird deutlich, dass allein Justins Fantasie, dass das, was ihn geweckt hat, eine Bedrohung sein könnte, seine Angst verursacht. Dadurch wird der wie gewohnt kühle Steinfußboden zu gefühltem Eis, das wie Feuer brennt (kein Widerspruch, denn große Hitze und extreme Kälte fühlen sich im ersten Moment nahezu identisch an). Das schon oft gehörte Geräusch eines belaubten Zweiges, der mit einem zischenden Klang über die Hauswand streicht, klingt wie eine riesige Schlange. Den Lampenfuß, der keinen Deut kälter ist als sonst, empfindet er als eiskalt und assoziiert damit sofort die Berührung einer Dämonenhand. Und das erloschene Licht führt seine Fantasie sofort auf die Sabotage eines Einbrechers zurück, der ihn vielleicht umbringen will. Seine Angst ist also „hausgemacht“ und hat ihre Ursache in seiner Furcht vor der Dunkelheit, die diese Fantasien erzeugt. Obendrein hat er auch noch Angst, von seinem Bruder für einen Feigling gehalten zu werden, der sich vor der Dunkelheit fürchtet. Deshalb lügt er ihm vor, er habe einen Albtraum gehabt. Womit Justin nebenbei subtil charakterisiert wurde. Denn sein Bruder, der ihn sein ganzes Leben lang kennt, wird diese Ausrede kaum glauben.
Nebenbei: Wer dieses Textbeispiel aufmerksam gelesen hat, hat bestimmt bemerkt, wie nahe Hass und Angst beieinander liegen. Justin hasst die Dunkelheit nur, weil sie ihm Angst macht. Dieses „nahe beieinander“ gilt auch für die Symptome von Angst und Hass. Wer die nachfolgende Liste mit der für Hass aus der vorigen Folge wird erkennen, dass einige Symptome/Reaktionen bei Hass und Angst identisch sind.
Übrigens: Dass im ersten Satz der Geschichte „platt“ steht, dass Justin die Dunkelheit schon immer gehasst hat, ist kein Widerspruch zum guten Beschreiben, sondern hier wird Justins Einstellung zur Dunkelheit aus seiner Perspektive wiedergegeben, als hätte er jemandem (zum Beispiel uns Lesenden) wörtlich gesagt: „Ich habe die Dunkelheit schon immer gehasst.“ Wenn WIR als Autorinnen/Autoren aber die Gefühle einer Figuren beschreiben, dann bitte „zeigend“ und nicht „behauptend“.
Vielleicht ist auch aufgefallen, dass in diesem Text keine der herkömmlichen Formulierungen steht, die man vielleicht erwartet hat. Hier schlägt kein Herz „bis zum Hals“, kein „Blut rauscht in den Adern“, auch der „trocken werdende Mund“ fehlt. Und das Wort „Angst“ kommt auch nicht vor. Der Grund: Diese Dinge sind sprachliche Klischees, die allzu oft schon gebraucht wurden, wenn es darum geht, Angst zu beschreiben.
Nebenbei: Diese Episode von Justins Angst ist bereits eine abgeschlossene Kurzgeschichte, die zeigt/zeigen soll, wie sehr die Fantasie in Form von Fehlinterpretationen uns beeinflussen kann. Die Pointe: Die vermeintliche Bedrohung ist nur ein Gewitter und alles „Gefährliche“ sieht buchstäblich bei Licht ganz anders aus und entpuppt sich als völlig harmlos.
Beim obigen Text handelt es sich um eine relativ lange Passage, in der die Hauptfigur kurz vor einer Panikattacke steht. Hier ist eine kürzere, in der es um eine „mildere“ Form von Angst geht, wie sie im normalen Alltag häufig(er) vorkommt:
„Kowalski! In mein Büro!“
Marlies zuckte zusammen. Nicht nur, weil Döring seine Aufforderung gebrüllt hatte, dass man ihn bestimmt noch draußen auf dem Hof gehört hatte, sondern weil sein Tonfall nichts Gutes verhieß.
„Wird’s bald?“, schnauzte er, als Marlies nicht sofort aufsprang und zu ihm eilte.
Doch Aufstehen schien ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, denn ihre Beine hatten sich in Pudding verwandelt, die das Gewicht des Körpers einfach nicht tragen wollten. Obendrein lag ein tonnenschwerer Stein in ihrem Bauch, der sie runterzog und dessen Kälte das Atmen lähmte. Sie stemmte sich am Schreibtisch hoch. Zitternd.
Döring starrte sie an, ein dämonisches Glitzern in den Augen. Er würde sie fertigmachen. Wieder einmal. Ihr wurde übel, ihr Mund trocken und sie bekam kaum noch Luft. Sie griff nach dem Stenoblock und dem Bleistift. Ihre Hände zitterten so sehr, dass der Stift ihr entglitt und zu Boden fiel.
„Ungeschickt lässt grüßen“, höhnte Döring. „Beeilung, Kowalski! Sonst sind Sie morgen Ihren Job los.“
Marlies kamen die Tränen. Sie brauchte den Job, um die Schulden abzuzahlen, die ihr Ex-Mann ihr hinterlassen hatte, sonst hätte sie schon längst freiwillig gekündigt. Hastig hob sie den Bleistift auf und wischte sich dabei die Tränen ab; unbemerkt, wie sie hoffte. Danach ging sie auf wackeligen Beinen, kaum noch eines klaren Gedankens fähig, in Satans Hölle hinter der Tür des Abteilungsleiters.
In diesem Text ergibt sich die Angst aus früheren Erfahrungen, die Marlies Kowalski mit ihrem Vorgesetzten gemacht hat. Sie weiß, dass er sie „fertigmachen“ will und wird und dass sie – warum auch immer – dem nichts entgegen zu setzten hat, sich nicht wehren kann/darf, weil sie sonst den so dringend benötigten Job verliert. Hier ist die Angst begründet und entspringt nicht, wie beim Beispiel mit Justins Angst vor der Dunkelheit, ohne konkreten Grund der Fantasie.
Aber auch hier wird die Angst hauptsächlich durch die Schilderung der Umstände und Marlies’ (unwillkürlicher) Reaktion darauf gezeigt. Es geht – natürlich – noch kürzer:
Sie roch Rauch. Sekunden später loderten die Flammen die Wand hoch und griffen auf die Gardinen über, breiteten sich aus und rasten auf Almuth zu. Ihr Denken setzte aus. Nur ein Gedanke blieb: Sie würde verbrennen. Bei lebendigem Leib. LAUF!, brüllte ihr Gehirn. LAUF LOS! Doch ihre Beine gehorchten nicht. Erst als vor ihr ein Teil der Decke einstürzte, riss sie das aus der Starre. Sie drehte sich um und rannte die Treppe hinunter, ignorierte, dass sie kaum Luft bekam, dass ein gefühlter Betonklotz an ihren Beinen sie niederdrücken wollte, dass Tränen ihr die Sicht raubten und die Angst ihr Herz zu zerquetschen schien. Sie rannte hustend weiter, ohne zu sehen wohin, den flammenden Tod an ihren Fersen.
In Kurzgeschichten dürfen wir, müssen sogar manchmal, um Anschläge zu sparen, der Textart angemessen, auch Formulierungen verwenden wie: „Sie erstarrte vor Angst.“ Oder: „Die Angst schaltete ihr Denken aus und ließ nur noch den (Überlebens-)Instinkt zu(rück).“
WICHTIGER Hinweis:
Gerade das Gefühl der Angst hat in der Literatur nicht nur die Aufgabe, den Gemütszustand der betreffenden Person zu beschreiben bzw. sie zu charakterisieren und/oder Spannung zu erzeugen. Sie verändert auch die Situation innerhalb der Szene oder für eine/alle künftige/n Szene/n. Sei es, dass sie die Figur lähmt oder so erschöpft, dass sie im Anschluss an die Angstsituation nur noch eingeschränkt handlungsfähig ist (wie bei Justin, der etliche Minuten braucht, um sich von dem Schrecken zu erholen); dass die Angst ihr Verhältnis zu jemand anderem verändert (der vielleicht über sie gelacht hat); dass sie durch die Angstsituation ein Trauma fürs Leben davonträgt; dass sie feige davonrennt, was ihr Selbstbild zutiefst erschüttert, weil sie sich bis dahin für einen mutigen Menschen hielt; oder dass die Angst bewirkt, dass die Person, nachdem sie sie durchgestanden hat, in einer ähnlichen Situation nie wieder Angst haben wird. Das sollten wir bei der Ausarbeitung unserer Texte berücksichtigen.
Damit wir möglichst viele „Vokabeln“ für die Beschreibung von Angst haben, ist hier die Liste der Symptome/Reaktionen, die dieses Gefühl begleiten:
- Körperlich: beschleunigter Herzschlag, beschleunigter Atem, Kurzatmigkeit, erhöhter Blutdruck (daher das Gefühl, dass das Herz „bis zum Hals“ schlägt und das Blut „in den Adern rauscht“), manchmal Gänsehaut (die Haare stehen einem „zu Berge“), Zittern, weiche Knie, aufgerissene Augen, Brustschmerzen, Mundtrockenheit, Ohrensausen, Schwindel (bis hin zum realen Hinfallen/Stolpern), flaues Gefühl im Magen (Vokabeln hierfür: Eisklumpen/Bleiklumpen/Stein/Brennen im Magen, der Magen fühlt sich eisig, eisenhart, „wie ein Fremdkörper/Betonklotz“ an, „steht in Flammen“ u. a.), Übelkeit bis zum Erbrechen, schwer oder nicht mehr zu kontrollierender Harndrang (man pisst sich tatsächlich manchmal vor großer Angst in die Hose), intensives Gefühl von Lähmung, verstärkte Adrenalinausschüttung (die u. a. für das Zittern verantwortlich ist), unkontrollierbares Weinen.
- Evolutionsbedingt sind im Gehirn nur zwei mögliche Reaktionen auf Angst „programmiert“: Flucht und Kampf. Ist Flucht nicht möglich, wird gekämpft und umgekehrt. Allerdings hängt es hierbei auch vom Temperament einer Person ab, ob sie grundsätzlich eher dazu neigt zu fliehen oder zu kämpfen. Ist die Angst groß genug, hat der Verstand nichts mehr zu melden, der einem z. B. inmitten einer Grube gefüllt mit Giftschlangen dringendst rät, zur Salzsäule zu erstarren und sich keinen Millimeter zu bewegen. Wenn der Instinkt übernimmt, wird dadurch der Verstand komplett ausgeschaltet.
- Eingeschränkte Motorik. (Das ist der Grund, warum wir das Schlüsselloch nicht „finden“ und uns der Schlüssel womöglich noch aus der Hand fällt, wenn wir verfolgt werden und ganz, ganz dringend in unsere sichere Wohnung müssen.) Auch die eingeschränkte Motorik ist auf die Programmierung „Flucht oder Kampf“ und den damit einhergehenden erhöhten Adrenalinausstoß zurückzuführen, der die Feinmotorik lähmt.
- Körperliche Erstarrung. Wenn das Gehirn sich nicht „entscheiden“ kann, ob es fliehen oder kämpfen soll, weil es das angstmachende „Grauen“ nicht einordnen oder ertragen kann, führt das manchmal zu Erstarrung: Der Geist will, dass der Körper etwas tut, aber dieser „Befehl“ erreicht die Muskeln nicht. Das sprichwörtliche „vor Angst (wie) erstarrt sein“ gibt es also tatsächlich.
- Wenn es sich um dauerhafte Ängste (Phobien) handelt, die nicht in einer konkreten Situation entstehen: Besäufnisse, Drogenkonsum und andere Süchte (Spielsucht, Arbeitssucht, Esssucht, Sexsucht etc.), um die Angst zu betäuben.
- Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit und das damit einhergehende Bewusstsein, aufgrund dessen der Situation oder Person(en) wehrlos ausgeliefert zu sein, was die Angst noch verstärkt oder sogar erzeugt.
- Das Gefühl, jeden Moment den Verstand zu verlieren. Was im übertragenden Sinn manchmal passiert, denn wenn die Angst von der Seele nicht mehr bewältig werden kann, klinkt sich das Gehirn aus und lässt keine bewusste Außenwahrnehmung mehr zu (Katatonie). Im schlimmsten Fall kann dieser Zustand Tage, Wochen oder sogar Jahre anhalten.
- Panikattacke: Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche, Erstickungsgefühl, psychischer und motorischer Kontrollverlust, Übelkeit, das Gefühl, jeden Moment zerspringt das Herz und/oder dass die Lunge „versteinert“ ist; damit einhergehende Todesangst. Das alles geschieht nahezu gleichzeitig. Bei Panikattacken erreicht der Pulsschlag tatsächlich manchmal eine so hohe Frequenz (oft über 200 Schläge pro Minute), dass die Gefahr eines Herzinfarkts besteht. Man kann tatsächlich vor Angst bzw. infolge der dadurch ausgelösten körperlichen Symptome sterben. Manchmal Bewusstlosigkeit.
- Synonyme für Angst (je nach Ursache und Intensität): Furcht, Entsetzen, Horror, Grauen, Schreck(en), Bangigkeit (veraltet), Schiss, Bammel, Muffensausen; bei krankhafter Angst: Phobie.
Wichtig fürs literarische Beschreiben von Angst ist natürlich die „Erwartung“, die dem Gefühl zugrunde liegt. Was tut der Verfolger mir an? Werde ich das überleben? Hinterher ein Krüppel sein? Wenn mich die Giftschlange beißt, sterbe ich einen qualvollen Tod (Angst vor der Qual und dem Tod). Wenn die Polizei mich erwischt, lande ich für den Rest meines Lebens im Gefängnis, verliere ich meinen Job, meine Existenz, stürze nach ganz unten ab und komme nie wieder auf die Beine. Und dergleichen mehr. Solche Befürchtungen sind die Ursache von Angst. Niemand hat z. B. Angst vor dunklen Orten oder der Nacht, wenn man nicht befürchtet, dass sich darin eine wegen der Dunkelheit unsichtbare Gefahr verbergen könnte, die einem zum Verhängnis werden kann. Die „Erwartung“ einer solchen Gefahr erzeugt die Angst.
Gerade Angst bzw. die Reaktion, wie unsere Figur damit umgeht, eignet sich hervorragend, um eine Person zu charakterisieren. Ist sie mutig, bekämpft/stellt sie sich ihrer Angst. Ist sie feige, rennt sie davon (Ausnahme: Situationen, in denen Flucht die einzig vernünftige Option ist) oder vernichtet das, was ihr Angst macht. Beschreiben wir, dass ein Mann seinem Freund nicht hilft, weil er finanziellen Verlust, Repressalien, Undank oder andere Nachteile befürchtet, brauchen wir nicht (mehr) zu schreiben: „Er ließ seinen Freund aus Angst vor den Folgen seiner Hilfe feige im Stich.“ Das ergibt sich aus den beschriebenen Überlegungen von selbst.
Nebenbei: Mut ist nicht, wie viele Menschen glauben, keine Angst zu haben, sondern die vorhandene Angst zu besiegen und das Richtige zu tun oder zu tun, was getan werden muss, obwohl man Angst hat, die man zu dem Zweck besiegt. Anders ausgedrückt: Mut ist, sich nicht von der eigenen Angst ins Bockshorn jagen zu lassen.
Handelt es sich um dauerhafte Ängste (z. B. vor Hunden), auch wenn sie nicht gerade krankhafte Phobien sind (z. B. Platzangst), haben wir den gesamten Roman-/Storytext lang Zeit, diese Gefühle unserer Figuren zu zeigen. Wir brauchen dafür nur zu beschreiben, dass der Held jedes Mal die Straßenseite wechselt, wenn er einen Hund sieht, oder dass er zu zittern anfängt, wenn er an einem Grundstück vorbeigehen muss, hinter dessen Zaun ein Hund die Passanten anbellt. Damit erübrigt sich zu sagen, dass er Angst vor Hunden hat. Erstarrt er jedes Mal und bekommt Atemnot, Herzrasen und Schweißausbrüche beim Anblick einer Spinne, müssen wir nicht zusätzlich schreiben, dass er unter Arachnophobie (krankhafte Angst vor Spinnen) leidet, denn das zeigt seine Reaktion mehr als deutlich.
Selbst wenn wir solche Dinge oder den Grund dafür thematisieren wollen, ist es nicht zwingend notwendig, das Wort „Angst“ zu gebrauchen: „Seit er als Kind von einer Spinne gebissen worden war, erstarrte er jedes Mal für Sekunden, wenn er so ein Tier sah und sei es noch so winzig.“ Als Andeutung genügt das. Den Rest erledigt die Fantasie der Lesenden. Wollen wir es deutlicher ausdrücken: „Seit er als Kind von einer Spinne gebissen worden war, raubte ihm der Anblick jeder noch so kleinen Spinne den Atem, ließ sein Herz rasen und er musste seine gesamte Willenskraft aufbieten, um nicht schreiend davonzurennen.“ Weil eine solche Reaktion für den bloßen Anblick einer Spinne nicht normal ist, müssen wir nicht betonen, dass der Held unter Arachnophobie leidet, denn den Schluss ziehen die Lesenden aus dieser Schilderung selbst.
Aber auch hier gilt, dass wir das in wörtlicher Rede selbstverständlich konkret ausdrücken können. Unser Held darf gern seiner Angebeteten oder einer anderen Person, die sich über seine in ihren Augen übertriebene Reaktion wundert, erklären: „Ich habe eine Scheißangst vor Spinnen.“ Oder der beste Freund sagt zu jemand anderem: „Seit er als Kind von einer Spinne gebissen wurde, hat er eine Heidenangst vor den Viechern.“
Kleine Tricks – große Wirkung.
In der nächsten Folge: Liebe
Weitere Folgen von „Show, don’t tell“:
- Gefühle beschreiben: Mut, Schock
- Landschafts- und Ortsbeschreibungen