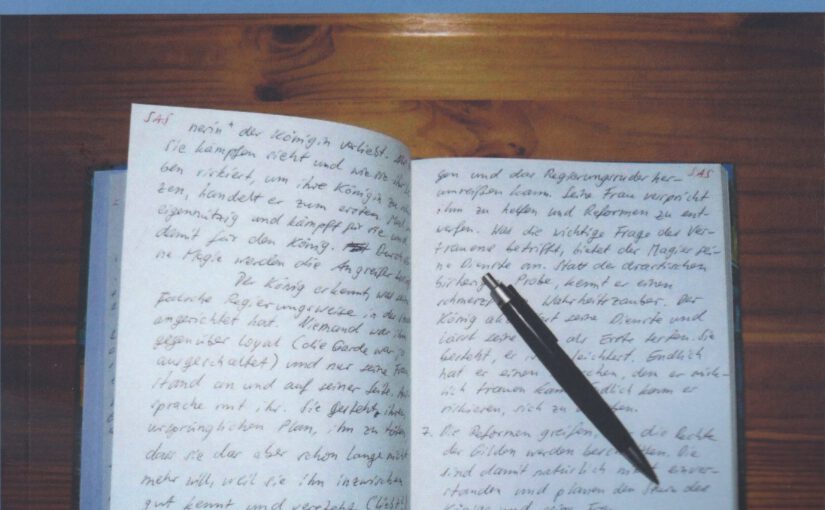Von der Kunst des Prosaschreibens – 4. Die Kunst des Endes
Tipps von Mara Laue
Den Schluss einer Geschichte, eines Romans zu schreiben – ist das nicht ganz einfach? Die Story ist doch zu Ende, also kann doch mit dem „Ende“ nichts schiefgehen – oder? Leider trifft allzu oft das „Oder?“ zu, denn ein guter Abschluss ist wie die Schlussnote eines Musikstücks, das ohne sie spürbar „unfertig“ in der Luft hängt. Ich lade zu einem Experiment ein: dem Singen der Schlussstrophe eines bekannten Liedes. Hört man zu singen auf, bevor man die letzte Note (oder die letzten drei) gesungen hat, fehlt dem Schluss etwas.
Dasselbe passiert auch für den Abschluss einer Geschichte, eines Romans. Deshalb gibt es für ein gutes Ende ein paar Dinge zu beachten.
Das Ende der Geschichte/des Romans muss wie der Rest der Story in sich schlüssig sein und bis auf ganz wenige Ausnahmen alle aufgeworfenen Fragen beantworten beziehungsweise die Antwort andeuten. Sämtliche bis dahin „offenen Enden“ müssen nun geschlossen werden. Selbstverständlich muss nicht nur das Schicksal der Hauptpersonen aufgelöst werden, sondern auch alle anderen Handlungsstränge müssen geschlossen werden, die bis zum Ende noch offen sind. Die einzige Ausnahme von dieser Regel bilden Fortsetzungsromane und Romanserien mit fortlaufendem Roten Faden. Hier muss die Auflösung erst am Ende des letzten Bandes der Serie erfolgen.
Besonders wichtig ist, dass auch das Schicksal von Personen, die im Verlauf des Romans eine wichtige Rolle spielten oder zu spielen schienen, aufgeklärt wird. Ein gekonnt aufgebauter falscher Verdächtiger in einem Krimi, der ab dem Punkt, an dem das Ermittlungsteam die Spur zum wahren Täter aufnimmt, im Roman nicht einmal mehr am Ende erwähnt wird, lässt die Frage danach offen, was es mit ihm auf sich hat. Schließlich ist er nicht aus heiterem Himmel in Verdacht geraten, sondern weil Indizien auf seine Täterschaft hindeuteten, er also mit dem Fall etwas zu tun hatte. Solche „im Stich gelassenen“ Figuren nennt man „Witwen“. Auch ihre Geschichte muss zwingend zu Ende erzählt werden, und sei es nur in einem oder zwei Sätzen, zum Beispiel indem die Kommissarin beim Verdächtigen anruft und ihm mitteilt, dass sich alle Verdachtsmomente gegen ihn erledigt haben und gegen ihn nicht mehr ermittelt wird. Eine Figur einfach fallen zu lassen, ist schlechter Stil.
Ebenso wichtig ist, dass der Schluss absolut folgerichtig sein muss und sich eindeutig aus den bisherigen Geschehnissen ergibt. (Fast) nichts verstimmt die Lesenden so sehr wie eine unlogische oder an den Haaren herbeigezogene Auflösung. Im Gegenteil muss die gesamte Handlung so aufgebaut sein, dass gar kein anderes Ende als eben dieses möglich ist (auch wenn es in sich noch ein paar mögliche Varianten trägt).
Dabei darf das Ende durchaus überraschend sein. Eine über die gesamte Handlung aufgebaute Verdächtige kann sich zum Beispiel als unschuldig entpuppen, aber die Begründung, warum der/die wahre Schuldige und niemand anderes die Tat begangen hat, muss passen.
Selbst bei dem für Liebesromane typischen (und vom Genre diktierten) Happy End kann man noch Spannung einbauen und die Lesenden überraschen, indem man die Art variiert, wie sich das Paar am Ende „kriegt“. Statt das linear zu schildern, kann man es scheinbar scheitern, im Streit auseinandergehen und die beiden dadurch erst erkennen lassen, wie viel sie einander bedeuten. Oder man lässt die Geschichte nicht mit den Hochzeitsglocken enden, sondern mit einem offenen Ende, das den glücklichen Ausgang aber andeutet und den Lesenden signalisiert, dass das Happy End jenseits des Buchdeckels stattfinden wird. Denn es wäre unglaubwürdig, wenn die Heldin z. B. die Verletzungen, die der Mann ihr zugefügt hat, einfach ignoriert und ihm trotzdem freudig um den Hals fällt, nur weil das Buch zu Ende ist und das Genre ein glückliches solches verlangt.
„WICHTIG, und zwar nicht nur für das Ende, ist, die Handlung und ihre Auflösung nicht durch einen Zufall passend zu machen!“ ZUFÄLLE SIND ALS LÖSUNGSMITTEL TABU! Immer. Natürlich gibt es im wahren Leben die unglaublichsten Zufälle; in einem Roman/einer Geschichte wird man sie uns als Lösung nicht abkaufen und auch nicht als Mittel, um der Handlung die von uns gewünschte Richtung zu geben. Eine Handlung, die nur durch einen Zufall oder noch schlimmer mehrere Zufälle ihr gewünschtes Ende erreicht, ist ebenso untragbar, wie den „Deus ex machina“ (Gott aus der Maschine) zu bemühen. Dieser Begriff, der ursprünglich aus dem altgriechischen Theater stammt, steht für eine unerwartet auftauchende Helferfigur in der Not, die die verfahrene Situation rettet, aus der unsere Hauptperson allein niemals herauskäme.
Realitäts-Check: Wie wahrscheinlich ist, dass genau DAS erforderliche Ereignis für die „Rettung“ der Situation in genau DEM Moment eintritt, in dem es dafür gebraucht wird? Nahezu null. Und ich sage ganz ungeschminkt: Wenn nur noch ein Zufall das Ende oder eine gewünschte Handlung passend machen kann, dann stimmt etwas mit dem Plot nicht. Zufälle sind immer unglaubwürdig.
Das Ende muss nicht zwangsläufig abrupt sein, zum Beispiel unmittelbar nach dem Showdown, wenn die Hauptfigur gerade von den Sanitätern verarztet wird und froh ist, noch am Leben zu sein. Es darf natürlich, wenn zu dem Zeitpunkt alle anderen Handlungsstränge bereits aufgelöst wurden und keine Fragen mehr offen sind. Ansonsten kann das Ende durchaus ruhig ausklingen. Vielleicht kommt am nächsten Tag die Polizei vorbei und erklärt der Heldin, welche Beweise man jetzt dank ihrer für die Verurteilung des Antagonisten hat. Oder der Held kommt nach längerer Abwesenheit nach Hause, freut sich auf eine Zeit der Ruhe und stellt fest, dass seine Frau ihn inzwischen verlassen hat.
Solche längeren Aufdröselungen werden oft in einem eigenen kurzen Kapitel behandelt, das meistens mit „Epilog“ (Nachwort) überschrieben ist. Auch ein solches Ende sollte nach Möglichkeit noch spannend geschildert werden. Dagegen sollte man auf Klischees unbedingt verzichten, weil sie eben „ausgelutscht“ und damit langweilig sind. Der einsame Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet, ist derart oft gebraucht (um nicht zu sagen missbraucht) worden, dass Lektorierende einen solchen Schluss nicht mehr dulden würden. Einen Liebesroman sollte man nicht mit den läutenden Hochzeitsglocken enden lassen, ebenso Floskeln wie „Morgen war/ist ein neuer Tag“ oder ähnliche unbedingt vermeiden (Ausnahme: Heftromane).
Offene Enden bleiben normalerweise den Fortsetzungsromanen vorbehalten und in seltenen Fällen auch dem Horrorgenre, wenn eben dadurch (dass zum Beispiel das Böse doch nicht vernichtet wurde und entkommen konnte) der Horror für die Lesenden nochmals gesteigert wird.
TIPP für Krimischreibende:
Man darf am Ende keinen Täter präsentieren, der bis dahin im Roman noch nie erwähnt wurde und nirgends eine Rolle spielte. Solche aus dem Nichts auftauchenden Figuren nennt man „Waisen“. Das wirkt an den Haaren herbeigezogen, in jedem Fall aber unglaubhaft. Täter/Täterin dürfen vorab gern in nur einer einzigen kurzen Szene erwähnt worden sein, aber sie müssen bereits vor dem Ende eine, wenn vielleicht auch kleine, Rolle gespielt haben.
In seinem Thriller „Velocity“ (deutscher Titel: „Irrsinn“) lässt Dean Koontz den Täter am Anfang des Romans, als er seinen Protagonisten Billy Wiles einführt, mit dem Antagonisten ein kurzes, scheinbar nichtssagendes und scheinbar für die Handlung irrelevantes Gespräch führen. Danach taucht die Person nicht mehr auf, bis sich am Ende herausstellt, dass sie der Täter ist und Meister Koontz uns in dieser Anfangsszene nicht nur den Protagonisten, sondern auch seinen Gegner vorgestellt hat. Damit ist diese Szene alles andere als nichtssagend oder irrelevant. Vielmehr erklärt sich aus ihr am Ende das Motiv für die Tat(en).
Nebenbei bemerkt: Das Ende der Story/des Romans ist natürlich noch lange nicht das Ende der Arbeit am Werk. Ist das letzte Wort geschrieben, hat man erst die sogenannte Rohfassung vorliegen. Die muss noch mindestens zweimal überarbeiten werden, wahrscheinlich aber mehrmals (mehr dazu in einer späteren Folge), bis man aus dem Rohdiamanten das Juwel geschliffen haben, das man schließlich einem Verlag anbieten kann.
Offenes Ende
Grundsätzlich haben nahezu alle Lesenden das Bedürfnis, das Ende einer Geschichte zu erleben, welches für die meisten bitte schön happy sein sollte. Held und Heldin überleben, die Liebenden kriegen sich und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage, die Bösewichte werden dingfest gemacht und ordentlich bestraft, eventuell sogar getötet, die Welt ist gerettet, die Rebellion gelungen und alles endet im sprichwörtlichen „Friede, Freude, Eierkuchen“ (auch wenn es der Gugelhupf ist oder ein Wildschweinbraten und der Barde geknebelt am Baum hängt, damit er den Mund hält).
Offene Enden mögen die Lesenden nicht so gern, sofern es sich nicht um das Ende eines Serienromans/einer Fortsetzungsstory handelt, bei dem/der das eigentliche Ende erst im letzten Band erfolgt. Um den Lesenden die Enttäuschung (und die damit meistens einhergehende Wut auf uns Autorinnen/Autoren) zu ersparen, dass das Ende offen ist, gibt es – wie meistens – einen probaten Trick. Er basiert auf dem Prinzip, dass sich die Lesenden das Ende denken können, auch wenn das, was sie denken, nicht zwangsläufig das Ende ist, das wir vielleicht im Kopf hatten.
Ein schönes Beispiel dafür ist der Jugendroman „Ich hätte Nein sagen können“ von Annika Thor. Der Inhalt: Ein Mädchen beteiligt sich am Mobbing einer Klassenaußenseiterin und sieht im Anschluss daran ein, dass das eine Sch…handlung war und sie hätte Nein sagen = nicht mitmachen sollen und können. Am Ende geht sie zum Opfer, um sich zu entschuldigen. Das Buch endet damit, dass das Mädchen an der Tür der Gemobbten klingelt. Ende. Nun bleibt es den Lesenden überlassen sich auszumalen, wie das geplante Entschuldigungsgespräch wohl ausgeht. Hört das Opfer überhaupt zu oder schlägt sie dem Mädchen die Tür vor der Nase zu? Verzeiht sie ihr? Ist sie unversöhnlich und jagt sie davon: „Ich will dich nie wiedersehen!“
Da wir (fast) alle ein glückliches Ende bevorzugen, werden die meisten Lesenden wohl die Versöhnung vermuten und trotzdem das Buch zufrieden zuklappen. Lesende, die selbst schon einmal Opfer von Mobbing geworden sind, werden vermutlich ein unversöhnliches Ende „denken“, bei dem die Täterin zum Teufel gejagt wird. Alles ist möglich, aber alle Lesenden werden trotzdem nicht oder nur mäßig enttäuscht sein wegen des offenen Endes.
Wenn man also ein offenes Ende außerhalb von Fortsetzungsromanen schreiben will, sollte man es in dieser Art gestalten. Beim Krimi sollten die Lesenden ahnen, dass der noch nicht gefasste oder sogar schon entkommene Verbrecher eines Tages doch noch erwischt wird. Oder dass der zu Unrecht Inhaftierte, dessen Schuld scheinbar zweifelsfrei feststeht, irgendwann „jenseits des Buchdeckels“ doch noch freikommt. Beim Liebesroman sollte das Happy End durch das geschriebene offene Ende ebenso möglich sein wie das Gegenteil.
Nebenbei: Ein offenes Ende ist eine hervorragende Möglichkeit, einen Fortsetzungsband oder eine Folgestory anzuhängen, auch wenn das ursprünglich nicht geplant war und nicht zwangsläufig erfolgen muss. (Mehr über das Schreiben von Mehrteilern in einer späteren Folge.)
In der nächsten Folge: Der Konflikt, das „Salz in der Suppe“ jedes guten Romans.