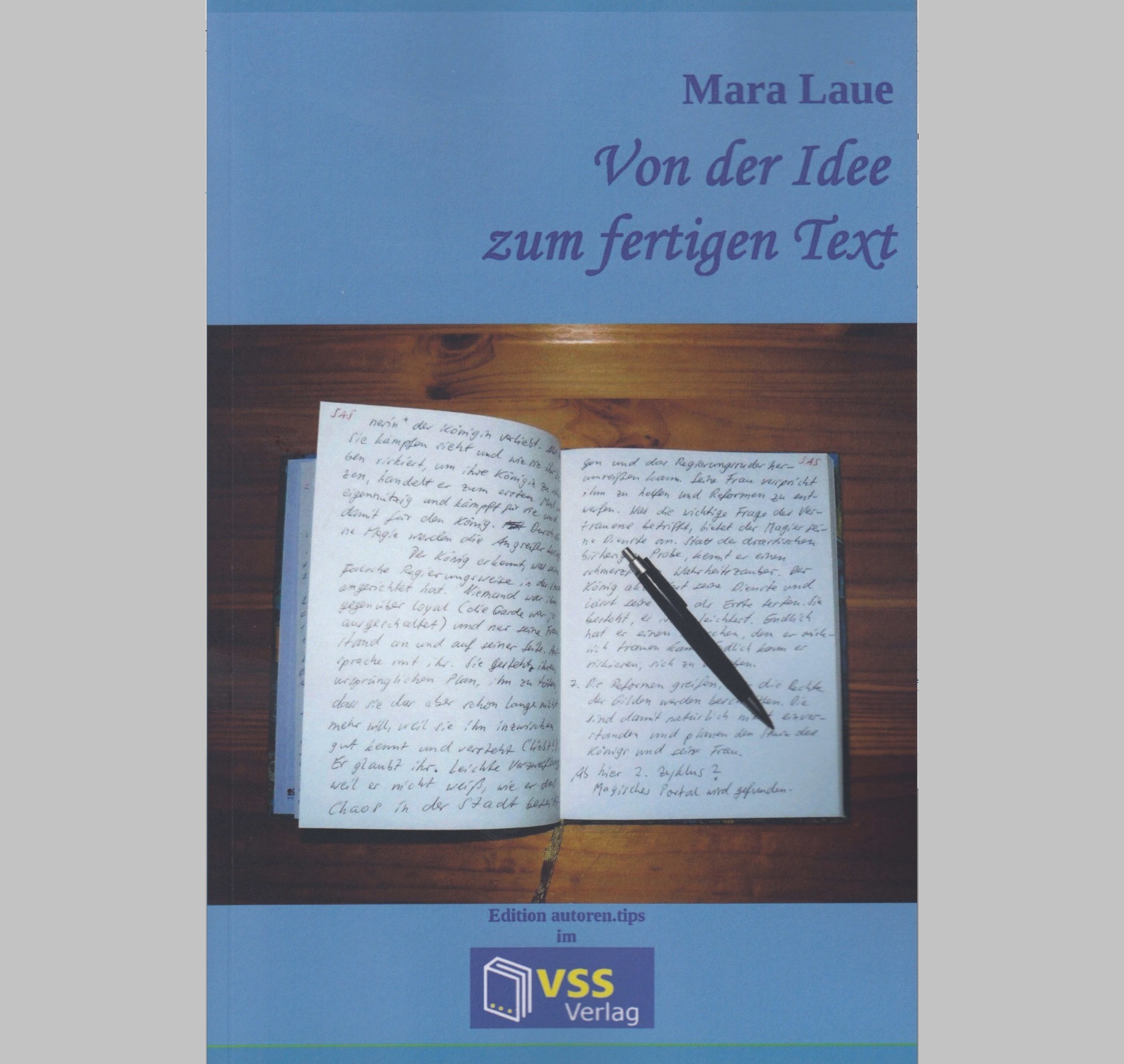Von der Kunst des Prosaschreibens – Das Exposé
Kluge Hinweise von Mara Laue
Das Exposé – nicht zu verwechseln mit dem Klappen-/Covertext, der auf der Rückseite/der Innenklappe eines Buches steht – ist neben dem Begleitschreiben die Eintrittskarte in einen Verlag. Es fasst auf nicht mehr als drei Seiten (in Ausnahmefällen vier, bei epischen Werken von 1000 Seiten und mehr dürfen es auch mal mehr sein) die wichtigsten Punkte des GESAMTEN Inhalts eines Romans zusammen, und zwar einschließlich des Endes, der Auflösung der Geschichte. Der Verlag muss sich ein vollständiges Bild vom Inhalt machen, um entscheiden zu können, ob der Roman auf dem Buchmarkt überhaupt Chancen hat. (Zwar gibt es einige sehr wenige Verlage, die sagen, dass sie das Ende gar nicht lesen wollen, um sich nicht die Spannung zu verderben, aber die sind die absolute Ausnahme. Ein professionelles Exposé offenbart immer auch das Ende.)
Das Exposé muss die klassischen „sieben W-Fragen“ beantworten: Wer hat was, wann (Handlungszeit der Geschichte, zum Beispiel Gegenwart, und/oder konkretes Datum/Uhrzeit), wie (auf welche Weise), wo (Handlungsort), mit wem (bzw. mit wem zusammen oder womit) und warum (Motiv) getan. Der innere, also logische Zusammenhang der Geschichte muss sich daran ablesen lassen. Jedoch konzentriert sich das Exposé ausschließlich auf die die Haupt- und allenfalls wichtigsten Nebenfiguren betreffende Handlung und geht nur dort ins Detail, wo eben dieses für das Verständnis des gesamten Zusammenhangs erforderlich ist. Nebenhandlungen, die nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben und diese nicht signifikant beeinflussen, werden im Exposé nicht erwähnt. Das gilt auch für jede Person, die nichts zur Entwicklung der Haupthandlung beiträgt.
Das Exposé wird immer im Präsens und immer auktorial geschrieben und enthält keine wörtliche Rede, auch keine Zitate oder Überschriften. Es unterliegt grundsätzlich ebenso wie das Manuskript den Gestaltungsvorschriften der Normseite (siehe übernächste Folge), es sei denn, der Verlag wünscht es anders oder schreibt kein Format vor. (Und sobald jemand „Hausautorin/Hausautor“ eines Verlages ist, muss man diese Vorschrift meistens nicht mehr einhalten, sofern der Verlag nicht darauf besteht.)
Man unterscheidet zwischen dem Rahmenexposé und dem Handlungsexposé. Das Rahmenexposé umfasst durchschnittlich zwei bis drei Seiten, ist eine Inhaltsangabe der Gesamthandlung und in der Regel chronologisch aufgebaut. Das Handlungsexposé gibt den Inhalt jedes einzelnen Kapitels bzw. Handlungsstranges oder jeder Szene wieder, und zwar in der Reihenfolge, in der sie auch später im Roman stehen. Das Handlungsexposé macht jeden Perspektivwechsel, jede Rückblende und jeden Cliffhanger mit, das Rahmenexposé gibt die Rahmenhandlung ohne diese Wechsel wieder.
Einem Verlag reichen wir immer das Rahmenexposé ein und nur auf dessen ausdrücklichen Wunsch ein Handlungsexposé.
Die meisten Autorinnen und Autoren hassen das Schreiben von Exposés. Das habe ich früher auch getan. Gemäß einem witzigen Spruch, der unter uns kursiert, „geht eher ein Elefant durch ein Nadelöhr, als dass sich ein 400-Seiten-Roman auf zwei bis drei Seiten eindampfen lässt“ (nach Hans Peter Roentgen in „Drei Seiten für ein Exposé“). Gerade Neulinge, aber manchmal auch sehr erfahrene Profis tun sich mit dem Exposé schwer. Die gute Nachricht ist: Auch das Verfassen des Exposés ist – wie die meisten Dinge im Leben – nur eine Frage der Übung.
So wird es gemacht
Wir schreiben zunächst ein Handlungsexposé. Dabei lassen wir die Länge außer Acht. Hier kommt es nur auf den Inhalt an. Wir prüfen, wenn wir fertig sind, ob die innere Logik stimmt, ob wir alle wichtigen Informationen aufgeführt haben und vor allem, ob die Lösung am Ende schlüssig ist. Am besten geben wir es einer neutralen Person zu lesen, denn Außenstehende erkennen unsere Fehler sehr viel besser als wir. Ist inhaltlich soweit alles in Ordnung, beginnt das Kürzen.
- Wir streichen alle Informationen, die nicht zwingend erforderlich sind für die Haupt- und damit verknüpfte wichtige Nebenhandlungen.
- Wir eliminieren alle Handlungsstränge jener Nebenfiguren, die nicht zur Haupthandlung gehören oder die für deren Verständnis/Entwicklung wichtig sind.
- Jede Szene, die am Ende übrig bleibt, fassen wir in so wenigen Sätzen wie möglich zusammen.
Wir sollten uns auch nicht scheuen, ein dreißigseitiges oder noch längeres Kapitel in einem einzigen Satz zusammenzufassen: „Entgegen den Anweisungen ihres Vorgesetzten ermittelt die Kommissarin weiter gegen den Verdächtigen.“ Wie sie das macht und welche Leute sie dazu befragt, ist für fast jedes Exposé mit entsprechendem Inhalt uninteressant. Nur das Ergebnis dieser Nachforschungen muss irgendwann genannt werden. Oder: „Aufgrund eines Missverständnisses durch eine falsch interpretierte Situation kommt es zum Bruch zwischen den Liebenden.“ Wie es zu dem Missverständnis gekommen ist, was genau dabei passiert ist oder wie die „falsch interpretierte Situation“ konkret aussieht, ist für das Exposé (meistens) unwichtig.
Nach diesem Rundumschlag im Streichen dürften nur noch ein paar Seiten übrig bleiben. Sind es immer noch mehr als vier Normseiten, müssen wir noch einmal prüfen, wo wir noch Informationen haben, die ein Verlag nicht unbedingt wissen muss, um sich ein Bild vom Inhalt des Romans zu machen. Eventuell können wir eine (zusätzliche) Kürzung durch das Umformulieren längerer Sätze erreichen. Im Exposé sollte man möglichst wenig mit eingeschobenen Nebensätzen arbeiten und diese in den Hauptsatz integrieren, wo es geht.
Obwohl man sich beim Exposé so kurz wie möglich fassen sollten, werden sich aber kaum Lektorierende/Verlegende weigern, ein Exposé zu Ende zu lesen, das mehr als die „erlaubten“ drei bis vier Seiten hat, wenn es sich um eine spannende Geschichte oder einen sehr komplexen Roman handelt. (Das Exposé von Ken Folletts „Säulen der Erde“ umfasste ca. 80 Seiten, das ist die ungefähre Länge eines Haftromans. Aber Bestsellerschreibenden sieht man so etwas nach.) Dennoch gilt gerade für das Exposé, dass in der Kürze die Würze liegt. Fakt ist: Wenn ein kurzes Exposé die Lektorierende nicht überzeugt, würde sie auch ein ausführliches nicht überzeugen.
Jedoch haben wir in diesem Stadium erst die Rohfassung unseres Exposés, die ein verkürztes Handlungsexposé darstellt. Nun müssen wir es als Rahmenexposé ausformulieren.
Das Handlungsexposé orientiert sich, wie schon gesagt, am Aufbau des fertigen Romans. Es macht alle Szenenwechsel, alle Perspektivwechsel, alle Cliffhanger der Romanhandlung mit (deshalb „Handlungs“exposé) und beginnt wie der Roman zum Beispiel mit der Vorgeschichte oder dem Ende, zu dem der Rest des Romans hinführt, oder mitten in einer Actionszene und stellt deshalb nicht unbedingt die Hauptfigur, den Ort und die Zeit vor, um die es im Roman geht. Das Rahmenexposé offenbart die Handlung erstens an der Figur der Hauptperson orientiert und schildert zweitens die Ereignisse chronologisch.
Das gilt auch für komplexe Romane, die auf zwei oder mehreren Zeitebenen mit zwei verschiedenen Hauptpersonen spielen. Wir schildern zuerst die komplette Gesamthandlung der Vergangenheit und können diese einleiten mit: „Im Jahr xxxx lebt N.N. als Bäuerin in …“ Haben wir die Vergangenheit „abgearbeitet“, gehen wir zur Gegenwart über: „Heute/Im Jahr xxxx lebt N.N.s Nachfahrin X.Y. auf dem Hof.“ Danach fahren wir mit den Ereignissen in der Gegenwart fort und erwähnen an passender (!) Stelle die Relevanz zur Handlung aus der Vergangenheit.
Grundsätzlich beginnen wir das Rahmenexposé damit, dass wir den Lesenden (den Lektorierenden/Verlagen) bereits im ersten Absatz die Hauptperson, den Handlungsort und den Kernpunkt oder Ausgangspunkt der Handlung vorzustellen. Eventuell beschreiben wir zusätzlich, mit welcher Handlung der Roman beginnt, falls sich das nicht bereits aus diesen drei Kriterien ergibt und diese Information für den Aufbau der Story wichtig ist:
„Die behinderte Privatdetektivin Stella Hundt wird von der Hamburger Künstlerin Olivia Jakob für die Beschattung ihres Mannes Gideon engagiert. Doch bevor Stella aktiv werden kann, kommt Olivia Jakob unter verdächtigen Umständen zu Tode.“
Hier erfahren die Lesenden Namen und Beruf der Hauptperson (Stella Hundt), den Handlungsort (Hamburg) und den Beginn der (Haupt-)Handlung sowie eine wichtige Besonderheit, die den Roman von ähnlichen des Genres unterscheidet: Die Detektivin ist behindert. In der dem Exposé angehängten Personenbeschreibung oder auch zwischendurch, wenn das wichtig ist, erfährt man, dass sie im Rollstuhl sitzt.
Wichtig ist, dass wir unabhängig vom Romanaufbau das Exposé mit dem Ereignis beginnen, an dem die eigentliche Handlung einsetzt. Die im Roman beschriebene Vorgeschichte, wie es dazu kam, ist für das Exposé in der Regel unwichtig.
„Martin hat sich nach einem halben Jahr reiflicher Überlegung dazu entschieden, Tischler zu werden und einen Ausbildungsplatz bei Tischlermeister Siebert gefunden.“
Dieser Satz berichtet zwar, dass der Roman offensichtlich mit dem halben Jahr von Martins Entscheidungsfindung beginnt, aber das ist für die Handlung unwichtig, soweit es das Exposé betrifft. Die eigentliche Handlung, ihr Ausgangspunkt, beginnt mit: „Martin ist bei Tischlermeister Siebert in der Ausbildung.“ Oder, falls Meister Siebert und die Ausbildung nicht im Mittelpunkt stehen: „Tischlerlehrling Martin … (es folgt, worum es geht)“.
Nach dieser Einleitung schildern wir den weiteren Verlauf der Geschichte zwar chronologisch, aber keineswegs nüchtern, sondern spannend. Dabei dürfen wir auch gern Fragen aufwerfen (die wir jedoch immer beantworten müssen und sei es am Ende der Geschichte):
„Stella steht vor einem Rätsel. Ist Gideon Jakob wirklich der Täter, worauf alle Indizien hindeuten, oder gibt es noch andere Personen, die ein Motiv hatten, Olivia zu ermorden? Um das herauszufinden …“
Vom Inhalt her entspricht Ihr Rahmenexposé dem Text, der nach der rigorosen Verknappung des Handlungsexposés übrig blieb. Jetzt bringen wir ihn in eine Form, die sich so interessant und spannend liest wie der Roman selbst. Deshalb sollten wir darauf achten, dessen Konfliktstruktur gut herauszuarbeiten und sie den Lesenden zu zeigen, statt lediglich zu sagen, dass und welche Konflikte es gibt. „Stella hat sich in Gideon verliebt und will deshalb nicht glauben, dass er seine Frau umgebracht haben könnte“, beinhaltet zwar den Konflikt, klingt in dieser Formulierung aber langweilig.
„Als immer mehr Beweise auftauchen, dass Gideon seine Frau ermordet hat, gerät Stella in einen tiefen Zwiespalt zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrem Wunsch, die Wahrheit herauszufinden. Ein Dilemma, dessen Lösung nach der gegenwärtigen Sachlage so oder so in einer persönlichen Katastrophe für sie enden wird.“
Das klingt erheblich interessanter und zeigt den Lesenden, was für Stella auf dem Spiel steht, statt nur zu sagen, dass der Konflikt existiert.
Auf diese Weise formulieren wir unser Exposé bis zum Schluss aus, an welchem wir uns vergewissern, dass alle losen Enden folgerichtig aufgelöst wurden und der Roman (idealerweise) mit einer unerwarteten Lösung aufwartet (sofern das Genre nicht die Art des Endes vorgibt, zum Beispiel ein Happy End).
Was den Verlag am Exposé vordringlich interessiert (neben den „sieben W-Fragen“):
- Ist das Thema interessant?
- Ist die Handlung spannend?
- Ist die Handlung einschließlich des Endes folgerichtig aufgebaut?
- Hebt sich der Plot positiv vom Gros der Romane desselben Genres ab?
- Gibt es einen überraschenden Schluss und/oder zwischendurch überraschende Wendungen?
- Gibt es genug Konfliktstoff?
- Enthält der Roman interessante Charaktere, die sich nicht schon dutzendfach auf dem Buchmarkt tummeln?
- Hat der Roman etwas Besonderes, das ihn aus der Masse heraushebt?
Sind wir uns sich sicher, dass unser Exposé diese Fragen beantwortet, schleifen wir es nun sprachlich so, dass es gut klingt. Danach widmen wir uns dem formalen Aufbau unseres Exposés.
Aufbau des Rahmenexposés
WICHTIG:
Ein professionelles Exposé enthält immer einen „Kopf“, der die nachfolgenden Punkte tabellarisch auflistet (Beispiel siehe unten). Und jedes Exposé beginnt wie auch jedes Manuskript mit unserem Namen und vollständigen Kontaktdaten.
Die Adressdaten stehen zusätzlich in der Fußzeile, in der Kopfzeile der Titel mit dem Zusatz „Exposé“ (oder umgekehrt) sowie die Seitenzahl rechts. Man kann auch beides in die Kopfzeile schreiben oder in zwei Zeilen, wenn der Titel so lang ist, dass die Kontaktdaten nicht mehr in die erste Zeile passen (1. Zeile: Titel mit dem Zusatz „Exposé“, 2. Zeile: Kontaktdaten); hierfür gibt es keine feststehende Vorschrift. Wichtig ist nur, dass wir unsere Kontaktdaten nicht vergessen zu nennen. Zwar befinden sich die bereits im Kopf des das Exposé begleitenden Anschreibens, aber es besteht die Möglichkeit, dass das Anschreiben vom Exposé getrennt wird. Jede Seite unseres Exposés und später unseres Manuskripts sollte sich schon auf den ersten Blick zweifelsfrei uns zuordnen lassen. Darunter steht nach 2 oder 3 Leerzeilen der Titel des Werkes mit dem Zusatz „Exposé“. Darauf folgt nach einer Leezeile:
- Die Nennung des Genres, zu dem der Roman gehört, eventuell das Subgenre. Beispiel: „Genre: Kriminalroman, Subgenre: Ermittlungskrimi“.
- Falls wir eine besondere Zielgruppe ansprechen wollen, wenn es sich bei unserem Beispielkrimi etwa um einen Roman mit einem regionalen Bezug handelt, so nennen wir in der nächsten Zeile die Zielgruppe: „Zielgruppe: Erwachsene im Raum Eifel“ oder „Jugendliche von 14–18 Jahren“.
- Zeit und Ort: Wenn es sich nicht um einen Fantasyroman handelt, vermerken wir, in welchem Zeitraum und an welchem Ort der Roman spielt: „Handlungsort: Berlin“, „Zeit: 19. Jahrhundert“ oder „Zeit(raum): Gegenwart, 3 Wochen im August“. Wir können beide Punkte auch zusammenfassen: „Ort: Berlin im 19. Jahrhundert“. Diese Angaben sollten wir auch bei Science-Fiction-Romanen machen, hier aber zumindest die (irdische) Zeit nennen, zu der die Handlung spielt, falls es mehrere Handlungsorte gibt: „Zorainor, 4. Planet des Ildris-Sonnensystems, im Jahr 2397“.
- In der nächsten Zeile vermerken wir, wie viele Anschläge das Manuskript hat: „Umfang: 435.000 Anschläge, 290 Normseiten“. (Anschläge sind alle Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen UND die Leerschritte.) Wir dürfen die Anschlagzahl runden und müssen nicht jeden einzelnen Anschlag nennen. Falls das Manuskript noch nicht fertiggestellt ist, die genaue Anschlagzahl also noch nicht bekannt ist, schätzen wir den Gesamtumfang. In dem Fall schreiben wir: „(Voraussichtlicher) Umfang: 430.000–450.000 Anschläge, 280–300 Normseiten“. Bei Neulingen sollte das Manuskript nicht mehr als 450.000–500.000 Anschläge haben, da die meisten Verlage sich scheuen, das Risiko eines umfangreicheren Erstlingswerks zu tragen. (Natürlich gibt es auch Ausnahmen.)
- Erzählperspektive: Der Verlag möchte wissen, in welcher Perspektive wir schreiben, z. B.: „Wechselnde personale Perspektive in der 3. Person Singular“ oder „Ich-Perspektive“.
- Lieferzeit: In die letzte Zeile des Exposékopfes schreiben wir, wie lange wir voraussichtlich brauchen werden, um dem Verlag das vollständige Manuskript einzureichen: „Lieferzeit: 2 Monate“. Neulinge sollten ihr Manuskript bereits fertig haben (zumindest in der ersten überarbeiteten Fassung), bevor sie es anbieten. Profis, die vom Schreiben leben, können es sich dagegen in der Regel nicht leisten, ein Manuskript erst anzubieten, wenn es fertig ist. Sie reichen zusammen mit dem Exposé eine Textprobe ein und schreiben den Roman nur auf Anforderung, das heißt Auftrag zu Ende. Dafür bekommen sie normalerweise 6 Monate Zeit. Für einen Profi mehr als ausreichend, das Werk zu vollenden und angemessen zu überarbeiten.
- Eventuell können wir nach der Lieferzeit (abgesetzt durch eine Leerzeile) noch „Das Besondere“ herausstreichen, das den Roman von (allen) anderen unterscheidet, sowie das „Thema“, das ihm zugrunde liegt. Vorausgesetzt, das lässt sich in einem kurzen Satz bzw. Stichworten formulieren: „Das Besondere: eine behinderte Detektivin“, „Thema: eiskalte Rache bis zur Selbstzerstörung“. Ansonsten schreiben wir es ans Ende des Exposés nach der Personenbeschreibung. Wir sollten beides aber immer dann dem Exposé voranstellen, wenn es zum besseren Verständnis des Inhalts erforderlich oder so außergewöhnlich ist, dass wir die Lektorierenden/Verlage sofort mit der Nase darauf stoßen wollen.
- Nach einer oder zwei Leerzeilen beginnen wir mit dem Text.
- Optional: Nach dem Text fügen wir eine kurze Beschreibung der wichtigsten (im Exposé genannten) Personen hinzu, um sie zu charakterisieren („Personenbeschreibung“). Hierbei beschränken wir uns pro Person auf einen Satz oder höchstens drei kurze Sätze, die ausschließlich die wichtigste(n) Eigenschaft(en) oder Charakteristika herausstreichen. (Fast) keine Lektorierenden interessiert für das Exposé, wie groß die Hauptperson ist oder welche Haar- und Augenfarbe sie hat. Wir schreiben nur das wirklich Wichtige: Winno Manninga: ein friesischer Maler Marke „Schlitzohr“, der seine Talente nicht nur zum Malen eigener Kunstwerke nutzt. Außerdem sollte die Personenbeschreibung, wenn sie am Ende des Exposés steht, hauptsächlich Informationen enthalten, die sich nicht bereits aus dem Text des Exposés ergeben haben. Ist darin alles Wichtige zu den Hauptfiguren gesagt, ist eine Personenbeschreibung überflüssig. Wenn sich aus dem Inhalt bereits ergibt, dass der Friese Winno Manninga ein schlitzohriger Kunstfälscher ist, müssen wir das nicht noch einmal am Ende des Exposés in der Personenliste erwähnen.
- Optional: Wenn wir unseren Roman als Serie oder Reihe konzipiert haben, schreiben wir das ebenfalls in den Exposékopf: „Serie/Reihe: 5-teilige Serie mit fortlaufender Handlung“. Oder: „Reihe aus in sich abgeschlossenen Einzelbänden mit unbestimmter Zahl“. Oder: „Kann als Reihe aufgebaut werden.“
Verarbeiten wir im Roman Fachwissen, dann sollten wir einen Hinweis geben, woher dieses Fachwissen stammt („Autorin-/Autorenqualifikation“). Haben wir einschlägige Erfahrungen auf diesem Fachgebiet? Fachleute interviewt? Gut recherchiert? Je kompetenter wir das verwendete Fachwissen belegen können, desto größere Chance bekommt das Manuskript.
Ein Trick, um die Lektorierenden „anzufixen“, also ihnen das Weiterlesen schmackhaft zu machen, ist, dem eigentlichen Exposé einen auf drei bis fünf Zeilen beschränkten Klappentext/Covertext voranzustellen, einen sogenannten „Pitch“. Denn gerade in großen Verlagen, die jeden Monat Hunderte von unverlangt eingesandten Manuskripten auf den Tisch bekommen, haben die Lektorierenden in der Regel nur zwei bis drei Minuten (!) Zeit, um zu entscheiden, ob das Werk etwas taugt. Aber auch kleinere Verlage, in denen es vielleicht nur ein oder zwei Lektorierende gibt, erhalten so viele Manuskripte, dass sie kaum längere Zeit zur Prüfung zur Verfügung haben. Deshalb ist ein packender Einstieg ins Exposé und später ein ebenso mitreißender Anfang des Romans so ungemein wichtig.
Der Pitch wird vom eigentlichen Exposé mit einer Leerzeile abgetrennt. Überschrieben wird er mit „Kurzinhalt“, „Pitch“ oder gar nicht, wenn wir Zeilen sparen wollen/müssen, um die drei Seiten nicht zu überschreiten. Wie wir als Lesende wissen, stellt der Klappentext den wichtigsten Teil des Inhaltes möglichst spannend dar, um die Leute zum Kauf des Buches zu verführen. Wir können dieses Mittel in Form des Pitches benutzen, um die Lektorierenden dazu zu veranlassen, zumindest unser Exposé vollständig zu lesen. Wenn sie das überzeugt hat, lesen sie auch die Textprobe, und wenn die sie überzeugt, den ganzen Roman.
TIPP:
Um Platz für das eigentliche Exposé zu gewinnen, können wir die Kontaktdaten wie auf dem Deckblatt des Gesamtmanuskriptes (siehe letzte Folge) als Adresse in mehreren Zeilen auflisten, darunter den gesamten Exposékopf schreiben, unter diesen den Kurzinhalt und den eigentlichen Exposétext auf der nächsten Seite beginnen. Wenn der Kurzinhalt die Lektorierenden/Verlage überzeugt hat, werden sie umblättern und das Exposé lesen. Haben Kopf und Pitch nicht überzeugt, würden sie auch nicht weiterlesen, wenn der Exposétext noch auf der ersten Seite beginnen würde. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Kurzinhalt möglichst appetitanregend und spannend ist, falls wir einen verwenden.
Der Exposékopf benennt tabellarisch also die folgenden Dinge (gerne kann diese Liste als „Maske“ verwendet werden):
- Titel
- Genre
- Subgenre
- Zielgruppe
- Handlungszeit
- Handlungsort
- Erzählperspektive
- Serie/Reihe (ja/nein)
- Anschlagzahl
- Lieferzeit
Normalerweise sind eine Kurzvita (literarischer Lebenslauf) und eine Bibliografie (Veröffentlichungsliste) NICHT Bestandteil des Exposés, sondern gesonderte Dateien. Doch viele Verlage gehen immer mehr dazu über, alles in einer einzigen Datei zu verlangen. Diese wichtige Information findet sich aber auf der Website der Verlage unter „Manuskripteinreichung“. Wird dieser Punkt dort nicht erwähnt, bleibt es bei 3 Dateien (oder nur 2 im Fall von wenigen oder noch keiner Veröffentlichung). WICHTIG: Jeder Dateiname MUSS den Titel des Manuskripts und/oder Autorin-/Autorennamen enthalten, damit man im Verlag die Dateien der richtigen Person/dem Werk zuordnen kann.
In der nächsten Folge:
Zündende Klappentexte schreiben
Abschlussfolge:
Manuskriptnorm und Verlagsanschreiben