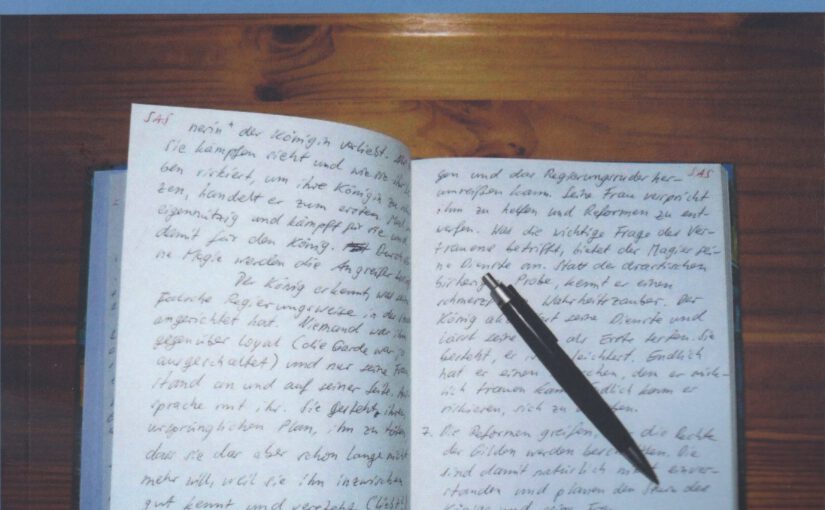Von der Kunst des Prosaschreibens – Die Kunst der Perspektiven
Kluge Hinweise von Mara Laue
8. Was zu beachten ist
Wenn wir uns sich für eine Perspektivart entschieden haben, MÜSSEN wir diese immer genau einhalten! Das klingt zwar einfach, hat aber seine Tücken. Die treten auf, wenn wir den Lesenden Informationen geben wollen, die für die handelnde Figur selbstverständlich sind, aber nicht für einen (Groß-)Teil der Lesenden. Hier neigen auch erfahrene Schreibende manchmal zu unschönem Infodump.
Beispiel:
Wir schreiben aus der Sicht eines Tischlers und lassen ihn beim Schnitzen eines Reliefs sein Werkzeug benutzen: Klüpfel, Schwalbenschwanz und Hundepfote. Dies sind Begriffe, die jeder Fachmensch kennt und die für eine Tischlerin oder einen Hobbyschnitzer keiner Erklärung bedürfen. Aber diese Fachleute dürften unter unseren Lesenden in der Minderheit sein. Um die Nichtfachleute unseres Publikums nicht unwissend im Regen stehen zu lassen, müssten wir erklären, was diese Dinge sind. Was wir jedoch auf keinen Fall tun dürfen, ist, diese Erklärung als Infodump oder Reflexionen der Handwerkenden einfließen zu lassen. Diese Leute sind FACH-Menschen, das heißt, dass sie sich über die Namen ihres Werkzeugs keine erläuternden Gedanken machen, weil sie für sie selbstverständlich sind.
Falsch – weil wir dann in Infodump oder sogar ins Auktoriale abgleiten – wäre deshalb eine Beschreibung wie diese:
Er nahm den Schwalbenschwanz, setzte ihn an und trieb ihn mit dem Klüpfel, dem hölzernen Rundhammer mit dem kurzen Stiel, ins Holz. Das Schnitzmesser hatte seinen Namen wegen der Form seiner Klinge bekommen, die an den Schwanz einer Schwalbe erinnerte.
Für den Schnitzer ist das völlig unerheblich, denn er weiß das und macht sich während der Arbeit mit diesem Werkzeug garantiert keine Gedanken darüber, warum es diese Bezeichnung trägt, welche Form es hat oder fühlt sich bemüßigt, sich selbst in Gedanken zu erklären, wie ein Klüpfel aussieht. Falls eine solche Information für die Lesenden wichtig ist (und im genannten Beispiel wäre sie das), haben wir mehrere Möglichkeiten, sie elegant in den Text einzuflechten.
1. Wir lassen den Tischler VOR Beginn seiner Arbeit überlegen, welche Schnitzmesser (Fachbegriff „Schnitzeisen“ oder nur „Eisen“) er für die Gestaltung seines Reliefs braucht: „Er betrachtete das auf das Holz aufgezeichnete Motiv. Die breiten Flächen konnte er am besten mit der ausgefächerten Klinge des Schwalbenschwanzes bearbeiten. Für die eckigen Vertiefungen brauchte er das Hundepfoteneisen.“ Schon haben die Lesenden eine ungefähre Vorstellung davon, wie das Werkzeug aussieht und warum es seinen Namen trägt. In der Regel genügen solche Andeutungen.
2. Wir benutzen einen Dialog und lassen einen Nichtfachmenschen in der Szene auftreten, dem der Schnitzer die Dinge erklären muss:
„Reich mir doch mal den Schwalbenschwanz und die Hundepfote“, bat Boris.
Igor blickte sich um. „Wo ist hier eine Schwalbe? Und eine Hundepfote sehe ich auch nirgends.“
Boris nickte zum Werkzeugtisch hin. „Das Messer mit der breitgefächerten Klinge ist der Schwalbenschwanz und das schmale viereckige mit der nach unten abgeknickten Klinge ist die Hundepfote. Den Klüpfel brauche ich auch. Das ist der Hammer da drüben, der wie eine kleine Holzkeule aussieht.“
Schon wissen die Lesenden Bescheid. Bei dieser Variante ist es wichtig, dass wir die Person, die den Handwerker zu seinen Erklärungen veranlasst, nicht nur zu diesem Zweck auftreten lassen. Sie muss zwingend in die Handlung integriert werden, z. B. mit einer wichtigen Botschaft oder Frage zum Handwerker kommen, die für die Handlung der Geschichte wichtig ist. Anders ausgedrückt, sie muss einen plausiblen Grund haben, um den Handwerker aufzusuchen. Nur „mal eben so vorbeikommen“ ohne besonderen Sinn ist tabu (es sei denn, das wäre ein charakteristisches Verhalten für die betreffende Person, die so etwas ständig grundlos tut).
Und noch etwas ist wichtig: Wir flechten solche Begriffserklärungen nur dann ein, wenn sie für den Text ERFORDERLICH sind. Sind sie das nicht, lassen wir sie und eventuell sogar die ganze erklärende Passage weg: „Boris machte sich daran, das Relief im Deckel der Truhe zu schnitzen.“ In den meisten Fällen genügt das. Falls solche Fachinformationen (oder andere Infos) für den ganzen Roman eine Rolle spielen, weil der Tischler die Hauptperson ist und viele Handlungen in seiner Werkstatt spielen, können wir unserem Roman einen „Hinweis für die Lesenden“ als „Vorbemerkung“ oder „Anmerkung der Autorin/des Autors“ voranstellen: „Eine Erläuterung der handwerklichen Fachbegriffe finden Sie im Glossar am Ende des Buches.“
3. Notfalls benutzen wir die schwebende Perspektive für kurze Erklärungseinschübe, in der ein Nichtfachmensch sich erläuternde Gedanken über die betreffende Sache macht: „Igor fragte sich, welchem Zweck wohl ein Messer diente, dessen Klinge an der Spitze wie ein Schwalbenschwanz verbreitert war.“ Nebenbei: Auch in der schwebenden Perspektive müssen wir innerhalb der handelnden Figuren bleiben. Das heißt: keine Facherläuterungen, während wir die Szene (noch) aus Boris’ Perspektive beschreiben.
4. Wir verzichten auf die Nennung solcher Fachausdrücke und schreiben nur, dass der Tischler mit seinem Spezialwerkzeug arbeitet, falls (!) diese Information wichtig ist.
Nicht nur Neulinge möchten gern die Authentizität ihrer Roman-Fachleute durch die Verwendung von Fachjargon unterstreichen. Da ihr „Fach“ untrennbar zur Hauptfigur gehört, ist das durchaus legitim und wichtig. Aber unsere Figur braucht immer einen plausiblen Grund, um die für sie selbstverständlichen Fachausdrücke und andere Dinge zu erklären. Lassen wir sie die ohne einen solchen beschreiben, fallen wir in diesen Passagen aus der gewählten Perspektive heraus bzw. der erklärende Text wirkt unpassend. Grundsätzlich sollten wir uns immer fragen, ob die Nennung von Fachbegriffen oder anderen sachlichen Informationen in unserem Text für die Authentizität unserer Figuren wirklich erforderlich ist. Wenn nicht, verzichten wir darauf.
BEISPIELE:
„Sie überprüfte das Magazin ihrer Pistole, ehe sie sie einsteckte.“ Unwichtig ist hier, die Marke der Pistole zu nennen, sofern die keine Relevanz für die Handlung hat, denn die Heldin macht sich in diesem Moment garantiert keine Gedanken darüber, ob sie eine Sig Sauer oder eine Colt Government in der Hand hat.
„Luis kämmte der Kundin das Haar mit dem Stielkamm.“ Perspektivbruch, denn Luis macht sich als Frisör garantiert keine bewussten Gedanken darüber, welchen Kamm er verwendet, sofern das nicht für die Frisur essenziell ist, also können wir das den Lesenden nicht mitteilen, während wir in Luis’ Perspektive schreiben. Ist eine solche Information wichtig, muss sie „von außen“ kommen, entweder aus einer anderen Perspektive oder als Dialog.
Spätestens beim Überarbeiten sollten wir unseren Text auf solche unpassend eingeflochtenen Erklärungen kontrollieren. Wir sollten uns immer fragen: Würde diese Person sich darüber wirklich Gedanken machen oder es bewusst bemerken? Wenn nicht, haben wir die schwebende Perspektive als Alternative.
Noch ein paar Beispiele:
Dem Menschen, der täglich in seinem Büro arbeitet, fällt die Einrichtung nicht mehr auf. Er hat also keinen Grund, sie ohne Anlass zu beschreiben. Wollen wir die den Lesenden zeigen, lassen wir einen Besucher aus dessen Perspektive das Büro beschreiben.
Der Weg, den der Held täglich oder wöchentlich zu seinem Ziel fährt, ist ihm so vertraut, dass er sich keine Gedanken darüber macht, dass er jetzt auf der Ludwigstraße fährt oder an der St. Martin Kirche vorbeikommt oder sich Gedanken über die Landschaft macht, falls sich in ihr nichts verändert hat oder etwas anderes Auffälliges dort ist, was vorher nicht existierte. Lassen wir jemanden, der mit dem Weg und seiner Landschaft nicht vertraut ist, diese den Lesenden zeigen.
Regeln, an die sich unsere Figuren halten sollen/müssen, werden nur dann thematisiert, wenn sie gebrochen werden. Denn wir alle richten uns täglich nach unbewussten Regeln im weitesten Sinn, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen, dass wir z. B. nach dem Zähneputzen nichts mehr essen (dürfen), weil wir sie dann nochmals putzen müssten. Oder dass wir beim Tischdecken das Besteck so hinlegen, dass das für den ersten Gang erforderliche Teil (der Suppenlöffel oder die Salatgabel) außen liegt und das für den letzten (der Dessertlöffel oder die Kuchengabel) innen. Dinge, die einem Menschen in Fleisch und Blut übergangen sind, thematisiert er nicht ohne konkreten Anlass.
Wichtig ist auch, dass wir unsere Figuren nicht „die Ärztin“, „der Verkäufer“, „das Kind“ etc. nennen, WÄHREND wir in deren Perspektive schreiben. Dies wären auktoriale Einschübe und damit Perspektivbrüche. Der Grund: Kein Mensch denkt von sich selbst als „Ärztin/Verkäufer/Kind“ etc.
Am einfachsten wird das in der Ich-Perspektive deutlich. „Ich“ spricht bzw. denkt immer nur von sich selbst als „Ich“. Sätze wie „Ich Ärztin/ich Verkäufer/ich Kind dachte mir, dass das vielleicht klappen könnte“, gibt es nicht. In der personalen Perspektive darf es sie ebenso wenig geben. Dort wird „Ich“ lediglich durch den Namen der Person oder „er/sie“ ersetzt, solange wir uns in der Perspektive dieser Person befinden. Schreiben wir dort „die Ärztin dachte“ wäre das ebenso, als würden wir unsere Ich-Figur „ich Ärztin dachte“ sagen oder denken lassen.
Manche (nicht nur) Neulinge argumentieren, dass sie diese Berufsbezeichnungen oder andere charakteristische Bezeichnungen (z. B. „der Blonde“, „die Kleine“, „der Dicke“ usw.) verwenden, um eine zu häufige Namensnennung zu vermeiden. Doch dafür genügt „er/sie“ vollkommen. Und alle paar Absätze und zur Vermeidung von Stilblüten können wir gern wieder den Namen nennen. Aber auktoriale Einschübe sind bis auf die wenigen, in vorigen Anleitungen genannten Ausnahmen tabu, weil sie die Perspektive brechen und die Lesenden dadurch aus dem Geschehen der Geschichte reißen.
Ebenso tabu ist auch eine Namensnennung in der folgenden Form: „Sie, Alice, dachte sich nichts dabei. – Um alles perfekt zu gestalten, stellte er, Tom, noch eine Rose auf den Tisch.“ Auch hier argumentieren Neulinge gern, dass sie verdeutlichen wollen, wer genau diese Handlungen vornimmt. Doch das ist in der Regel überflüssig. Entweder: „Sie dachte sich nichts dabei. – Um alles perfekt zu gestalten, stellte er noch eine Rose auf den Tisch.“ Oder: „Alice dachte sich nichts dabei. – Um alles perfekt zu gestalten, stellte Tom noch eine Rose auf den Tisch.“ Andernfalls haben wir denselben Effekt wie oben mit „die Ärztin“ usw: „Ich, Alice, dachte mir nichts dabei. Um alles perfekt zu gestalten, stellte ich, Tom, noch eine Rose auf den Tisch.“ So denkt von sich kein Mensch; Egomanen vielleicht ausgenommen.
Wenn wir die schwebende Perspektive benutzen oder anderweitig abgrenzen wollen/müssen, dass Alice und nicht Johanna, dass Tom und nicht Henry das Betreffende tut, genügt die einfache Namensnennung: Alice dachte …, Tom stellte … Die Lesenden sind nicht dumm und erkennen in der Regel ohne solche Dopplungen von „er/sie + Namensnennung“, um wen es in der betreffenden Passage geht.
Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es nur, wenn wir die Person oder ihren Status oder ihre Wichtigkeit (reale oder deren eingebildete) besonders betonen wollen: „Er, Geromir, König von Gottes Gnaden, musste diesen unerträglichen Zustand beenden. Sie, Alice, würde tun, was alle anderen nicht geschafft hatten.“ Hier wird – auch innerhalb der Perspektive der betreffenden Person – durch die explizite und normalerweise überflüssige Namensnennung die Entschlossenheit der Person betont: „Ich, König Geromir – nicht irgendjemand anderes –, werde diesen Zustand beenden. Ich bin Alice, nicht irgendwer, und deshalb werde ich schaffen, woran alle anderen gescheitert sind.“ Allerdings sollte man diese Ausnahmen wirklich auf solche seltenen Situationen beschränken und weitestgehend auf sie verzichten.
Die Perspektive einzuhalten ist nicht immer einfach. Aber durch Übung schafft man auch das im Laufe der Zeit problemlos.
Wo der Hase im Pfeffer liegt
Manche haben sich schon mit dem guten dem Beschreiben schwergetan und sind immer wieder ins Erzählen/Aufzählen verfallen. Möglicherweise hat sich „die Krise“ nach der Lektüre dessen, was wir alles bei den verschiedenen Perspektiven beachten müssen, noch verschärft, weil wir festgestellt haben, wie fehleranfällig der Versuch ist, eine Perspektive „sauber“ und ohne Bruch zu schreiben. Manch eine/r zweifelt sogar an den eigenen schreiberischen Fähigkeiten und/oder fragt sich, warum, um alles in der Welt, es so schwerfällt zu beschreiben, statt zu erzählen und ausschließlich in der personalen Perspektive zu bleiben, ohne ins Auktoriale abzugleiten an Stellen, wo das nicht angebracht ist.
Die Erklärung für dieses Phänomen ist im Grunde genommen ganz einfach und liegt NICHT daran, dass wir „zu blöd“ wären, die Tricks und Kniffe zu begreifen. Schuld ist die sprichwörtliche „Macht der Gewohnheit“ und wie stark sie uns prägt. Sehen wir uns unsere ganz normale alltägliche Kommunikation einmal genau an. Wir erzählen (!) in der Ich-Perspektive und wir berichten auktorial, wenn wir über jemand/etwas anderes erzählen als uns selbst. Hatten wir eine angstmachende Begegnung mit Nachbars Schäferhund und erzählen davon im Freundeskreis, sagen wir: „Mensch, da hatte ich aber eine Scheißangst!“ Wir kämen nie auf den Gedanken, in bester Beschreibungsmanier nach „Show, don’t tell!“ detailliert zu beschreiben, wie sich die Angst angefühlt hat, was genau wir dabei empfunden haben, dass unser Herz raste, uns der Schweiß ausbrach etc. (Einzige Ausnahme: Wenn wir im Rahmen einer Psychotherapie konkreter unsere Gefühle beschreiben müssen/wollen.)
Berichten wir dem besten Freund/der besten Freundin von dem tollen Menschen, dem wir gestern begegnet sind und in den wir uns Knall auf Fall verliebt haben, beschreiben wir NICHT in bester „Show“-Manier: „Die Haare leuchten wie ein reifes Weizenfeld, und die Augen erinnern mich an das Meer in der Sommersonne. Und dieser ansprechende Kontrast der schwarzen Jacke zum blutroten Hemd weckte in mir den Wunsch, ihr/ihm das auf der Stelle auszuziehen.“ Nein, so reden wir nicht, wenn wir uns nicht lächerlich machen wollen. Wir erzählen auf die Frage, wie die Person denn ausgesehen hat: „Blonde Haare, blaue Augen, und die schwarze Jacke zum roten Hemd fand ich total sexy.“
Und das ist der gravierende Unterschied zwischen unserer normalen Alltagssprache, die wir auch in unseren Schulaufsätzen geschrieben haben (und die wir unsere Figuren in deren wörtlicher Rede sagen lassen dürfen), und der literarischen Ausdrucksweise. Die Tücke: Weil wir, seit wir zu sprechen gelernt haben, unser gesamtes Leben lang auf diese Weise kommunizieren, fällt es uns zunächst wahnsinnig schwer, von dieser Gewohnheit, die für uns normal ist, abzuweichen und auf „Beschreibung“ umzudenken. Hier hilft wirklich nur Übung, Übung, Übung und noch mehr Übung, bis wir „im Schlaf“ in der Sekunde, wenn wir uns an den PC setzen, um eine Geschichte, einen Roman zu schreiben, von „Alltagssprech“ auf „Literatursprech“ umschalten können.
Wie alle neu zu lernenden Dinge braucht das seine Zeit. Bis diese Zeit vergangen ist, macht man Fehler und fällt zwischendurch immer wieder in die jahrzehntelange Gewohnheit der Alltagserzählsprache zurück. Das ist ganz normal! Im Lauf der zunehmenden Schreiberfahrung wird man sich aber an die literarische Ausdrucksweise gewöhnen. Deshalb besteht kein Grund zur Verzweiflung oder gar zum Aufgeben, wenn sich der „Alltag“ immer wieder in die Texte einschleicht.
In der nächsten Folge:
- Dialoge – eine Kunst für sich: Einführung
In weiteren Folgen:
- Dialogformatierung: ein Stolperstein für Neulinge
- Sprachhinweise und Unterfütterungen
- Männer reden anders. Frauen auch.
- Dialekte und Fremdsprachigkeit
- Nonverbale Dialoge
- Innerer Monolog, erlebte und indirekte Rede