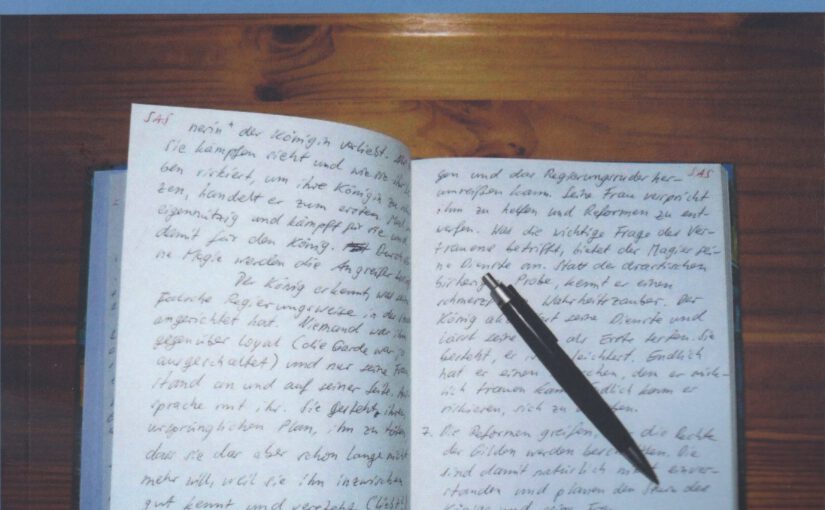Von der Kunst des Prosaschreibens – Figurenzeichnung: Erschaffen glaubhafter Charaktere
Teil 3: Der Name – eine Wissenschaft für sich
von Mara Laue
„Nomen est Omen“ („der Name ist ein Vorzeichen“) wusste schon das alte Latein. Das gilt ganz besonders für unsere Hauptfiguren, weil jeder Name gewisse Vorstellungen in uns weckt und unser Ziel ist, dass die Lesenden sich mit den Personen identifizieren können (oder die negativen Figuren leidenschaftlich ablehnen). Mit einem Protagonisten, der Franz Meyer heißt, wird sich kaum jemand anfreunden können, ebenso wenig mit einer Heldin, die auf den Namen Marlene Schulz hört. Hinter beiden Namen vermuten wir auf Anhieb eher hausbackene, nichtssagende Typen, die mindestens im Rentenalter sind.
Namen für unsere Haupt- und Nebenfiguren zu wählen, ist zuweilen ein ganz schönes Stück Arbeit, weil man einige wichtige Dinge beachten muss. Zunächst einmal muss der Name zur Person passen. Das klingt auf den ersten Blick banal, ist es aber nicht, denn jeder Mensch assoziiert mit bestimmten Namen zumindest in unserem Kulturkreis bestimmte Bilder. Bei einer Carmen denkt man unwillkürlich an eine Frau/ein Mädchen mit südländischem Aussehen, wenn auch nicht unbedingt entsprechender Abstammung. Eine blonde Carmen würde irritieren. Umgekehrt erschiene uns ein Spanier namens Siegfried als unglaubhaft oder sogar lächerlich (es sei denn, es handelt sich um einen Spitznamen oder Migranten), da wir mit diesem Namen einen eher hellhaarigen nordischen Typ verbinden. Ebenso unglaubhaft würde uns (in Deutschland) ein achtzigjähriger Kevin oder ein Teenager namens Karl anmuten, da diese Namen nicht zu der jeweiligen Generation passen (obwohl der Trend, Kindern altdeutsche Namen zu geben, gegenwärtig wieder steigt). Einen Alois würde man kaum als Bewohner eines Orts an der Nordsee vermuten (es sei denn, er wäre Tourist oder zugewandert) und eine Svenja sicherlich nicht für eine Italienerin halten.
Obwohl (nicht nur, aber gerade auch) in Deutschland ausländische Namen für Kinder immer beliebter werden, müssen wir Autorinnen/Autoren streng darauf achten, dass der Vorname auch zum Umfeld passt. Bei einem in Deutschland spielenden Roman mit deutschen Figuren wäre irritierend und deshalb unpassend, wenn diese Leute Jimmy, Hilary, Morgan, Tyler, LeBron oder Shanice mit Vornamen hießen. Hier sollten wir unbedingt recherchieren, welche Vornamen in dem Jahr, in dem unsere Figuren geboren sein sollen, am beliebtesten in unserem Land waren. Unter dem Stichwort „beliebte Vornamen“ gibt es im Internet Listen der in jedem Jahr am häufigsten für Neugeborene gewählten Vornamen.
Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Spielt Ihre Handlung zum Beispiel in Schottland, heißt der schottische Held garantiert nicht Johannes oder Pierre oder Carlos, sondern Ia(i)n, Peadar oder Tèarlach. (Das sind die original schottisch-gälischen Entsprechungen. Aussprache: Ijen, Petter und Tschärlach.) Oder, wenn er beziehungsweise seine Eltern nicht zu den Traditionsbewussten gehören, die die gälischen Namen verwenden, heißt er Cameron, Con(n)or, Douglas, Don(n)al oder Angus oder hat einen „normalen“ englischen Namen.
Ähnliches gilt für die Nachnamen. Sie müssen noch mehr als die Vornamen zur Herkunft der Person passen. Ein Rancher in einem Westernroman mit dem nordischen Namen Sigurdsson klänge nicht nur unglaubhaft, sondern sogar lächerlich, selbst wenn es tatsächlich einen solchen gegeben haben sollte. Eine Frau Hauptli assoziieren wir mit der Schweiz, ein Herr Rösenbichler stammt definitiv aus dem Alpenraum, und eine Frau Leclerc ist für uns ganz klar eine Französin (auch wenn sie Belgierin oder eine Deutsche mit einem französischen Elternteil ist oder mit einem Franzosen/Belgier verheiratet sein könnte). Nachnamen für unsere Figuren finden wir in Telefonbüchern oder den Abspannen von Filmen. Besonders Letztere sind eine wahre Fundgrube, gerade für ausländische Namen.
Natürlich müssen auch Vor- und Nachnamen klangmäßig nicht nur zur Person, sondern auch zueinander passen. Eine „Kara Karedis“ klingt eher nach Gestotter als nach einem Namen für unsere Hauptperson, und ein „Lutz Bark“ hört sich mehr nach Revolverschüssen an, als nach dem Namen des feurigen Lovers in unserem Roman. Außerdem sollte der Vorname nicht mit demselben Buchstaben oder Klang enden, mit dem der Nachname beginnt, weil das in manchen Fällen nicht gut klingt oder sich sogar schwieriger aussprechen lässt. Vor- und Nachname sollten zumindest für unsere Hauptfiguren melodisch und „ohne Kanten“ klingen.
Sogar zum Beruf muss der Vorname unserer fiktiven Person passen; zumindest wenn die Geschichte in Deutschland spielt. Warum? Weil wir mit gewissen Vornamen die Zugehörigkeit zu bestimmten Bevölkerungsschichten verbinden. Leute aus der sogenannten bildungsfernen Schicht würden mangels entsprechender Bildung ihre Tochter kaum Kassandra oder einen Sohn Viktor nennen. Deshalb würde uns irritieren – im realen Leben wie im Roman/in der Story –, wenn uns eine Kassandra und ein Viktor als ungelernte Fabrikarbeitende begegnen würden, da solche Namen eine Herkunft aus gehobenen Kreisen andeuten, in denen die Menschen in der Regel anderen Berufen nachgehen. Eine Ausnahme und somit glaubhaft wäre, wenn es sich um eine Geschichte handelt, die den Absturz des Bankiers Viktor X oder der Ärztin Kassandra Y in den Bezug von ALG II („Hartz IV“) thematisiert.
Ähnliches gilt auch, wenn nicht ganz so intensiv, für amerikanische Namen. Etliche Vornamen werden dort mit einer Zugehörigkeit zur afroamerikanischen Bevölkerung assoziiert. Dazu gehören Namen wie Shanice, LeBron, Dante, LaToya und Alisha/Aleesha (ursprüngliche Schreibweise: Alicia). Wichtig ist bei der Verwendung von ausländischen Namen auch, auf die Herkunft zu achten. Zum Beispiel ist in Afrika die Stammesvielfalt derart groß und jeder Stamm hat eigene, stammestypische Namen, dass wir genau recherchieren müssen, ob der von uns ausgesuchte Name tatsächlich zu der Herkunft unserer fiktiven Person passt. Wenn wir versehentlich einem Hutu den typischen Namen eines Ashanti geben, so wissen alle aus Afrika Stammenden und Afrikaerfahrenen, dass die Autorin/der Autor von Afrika wenig Ahnung oder schlecht recherchiert hat. Gerade solche Fehler machen unsere Geschichten unglaubhaft und schmälern damit den Lesegenuss unseres (wissenden) Publikums.
Ferner sollten wir darauf achten, dass Namen für verschiedene Personen nicht zu ähnlich klingen sollten. Sarah und Sandra werden zumindest zu Anfang des Lesens ebenso leicht verwechselt wie Jonas und Joris oder Peter und Petra. Und so manche allzu flüchtig Lesenden haben schon Namen verwechselt, die uns völlig unterschiedlich und unverwechselbar erscheinen. Da wird aus Chaim ein Liam gemacht, Paula zur Laura, Claudia zur Clarissa, Christa zur Christiane, Eva zur Ella, Berta zur Marta und sogar Juliane wurde schon mit einer Jarmila verwechselt. Die einzige Ausnahme bilden die Namen für Zwillinge, wenn das Verwirrspiel beabsichtigt ist. Ansonsten sollten wir unseren Figuren ihre Individualität gönnen.
Dasselbe gilt natürlich auch für Nachnamen. Steinprinz und Steinmann sind ebenso verwechslungsgefährdet wie Laermann und Hermann, Janssen und Jussen, Mühlfeld und Müller, Junker und Jünger, Ahlfels und Feldkamp etc., auch wenn uns das teilweise unwahrscheinlich erscheint. Besonders bei Figuren, die nur selten oder einmalig vorkommen und die deshalb den Lesenden nicht gut im Gedächtnis bleiben (sollen), passieren solche Verwechslungen sehr leicht.
Zu beachten ist ebenfalls, dass die Namen keine erkennbare Anlehnung an Figuren anderer, bekannter Romane haben dürfen. „Hercule“ ist durch Agatha Christies Detektiv „Hercule Poirot“ derart geprägt, dass wir ihn nicht mehr verwenden können, weil man uns dann sofort unterstellt, ihn abgekupfert zu haben. Außerdem dürften alle Lesenden, die Poirot kennen, bei jeder Nennung von „Hercule“ eben den Hercule Poirot vor Augen haben. Ausnahme: Es handelt sich um einen Spitznamen, der aber in der Geschichte als solcher erklärt werden muss. Dasselbe gilt für eine „Miss Marple“ (selbst wenn unsere nicht „Jane“ mit Vornamen hieße) oder einen „Sherlock“. Letzterer wäre aber als Name für einen Spürhund durchaus passend, gerade wegen seines Hinweises auf Sherlock Holmes und dessen überragenden detektivischen Spürsinn.
Grundsätzlich sollten wir immer darauf achten, dass wir etwas Eigenes, Unverwechselbares entwerfen und keine literarischen Personen zu imitieren versuchen, ganz gleich wie sehr sie unsere Vorbilder sein und ihre Namen uns gefallen mögen.
Dies gilt besonders für Fantasystorys/-romane. Natürlich ist es einfach und auch verlockend, sich an berühmte literarische Vorbilder anzulehnen; aber wenn uns nicht gelingt, gerade hier etwas Individuelles zu schaffen, geraten wir schnell zu Recht in den Verdacht, nicht genug Fantasie zu besitzen. Wer seine Elfen „Lelas“ oder „Gladril“ oder seinen Zwerg „Grimmli“ nennt (alle drei echte Beispiele aus realen Romanen/Storys), verrät auf den ersten Blick, dass er sich bei Tolkiens Figuren Legolas, Galadriel und Gimli bedient hat. Dabei würde, wenn man sich schon an solchen Vorbildern orientiert, der Austausch einiger Buchstaben genügen, um völlig neue Namen zu erschaffen: Legolas – Ketolar; Galadriel – Tamadrial; Gimli – Nimlo. Ebenso effektiv ist, Namen rückwärts zu schreiben oder Silben zu vertauschen, um etwas Neues entstehen zu lassen: Legolas – Salogel (rückwärts) oder Lasgolé (vertauschte Silben, und der Akzent auf dem e wirkt zudem exotisch). Man kann auch willkürlich Silben zu klangvollen Namen zusammenfügen, die wir sogar aus Allerweltswörtern zusammensetzen können: „gehen“ + „rennen“ = Geren(n), „lesen“ + „stehen“ = Lesten, „Baum“ + „Lyra“ = Aumyra/Umyra und so weiter.
Die wichtigste Prämisse bei allen Namen lautet jedoch, dass die Lesenden in der Lage sein müssen, sie auszusprechen. Das ist besonders bei ausländischen Namen zu beachten. Zwar kann man nicht jede Sprache und ihre Ausspracheregeln beherrschen; doch wenn man einen ausländischen Namen für eine Figur wählt, so sollte man erstens die korrekte Aussprache recherchieren (z. B. im Internet unter dem Stichwort „Aussprache von …“) und zweitens eben diese in irgendeiner Form in den Text einflechten. Nehmen wir den irischen Namen „Siobhan“. Um den Lesenden die korrekte Aussprache zu erklären, könnte man eine Szene schreiben, in der zum Beispiel eine Amtsperson diesen Namen vom Ausweis abschreibt und dabei anmerkt: „Sie-oh-bann? Komischer Name.“ Worauf unsere fiktive Siobhan korrigiert: „Das spricht man ‚Schiwonn’ aus.“ (Das ist die gälische Form von Johanna.) Und schon wissen die Lesenden Bescheid. In so einem Fall sollte die Ausspracheerklärung natürlich möglichst früh zu Anfang der Geschichte/des Romans erfolgen. Sollte eine solche Szene aus dramaturgischen Gründen nicht möglich sein, so ist es vorteilhaft, die Aussprache auf eine Extraseite vor das erste Kapitel zu setzen als „Anmerkung(en) zur Aussprache“ oder bei mehreren Namen darauf hinweisen, dass eine solche Liste am Buchende aufgeführt ist.
Relevant werden solche scheinbaren (!) Kleinigkeiten spätestens dann, wenn jemand anderes als die Autorinnen/Autoren den Text auf einer Lesung vortragen. Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem in einem Lesekreis ein alter Sam-Spade-Roman (von Dashiell Hammett) vorgelesen wurde und die Vorleserin – des Englischen nicht mächtig – aus Sam Spade einen „Sahm Schpahde“ machte. Aus diesem Grund sollte man nach Möglichkeit zumindest für die Hauptperson(en) Namen wählen, deren Aussprache den meisten Lesenden unseres Landes geläufig ist oder die so gesprochen werden, wie man sie schreibt. Denn es fällt den Lesenden unglaublich schwer, sich mit Personen zu identifizieren, deren Namen sie nicht oder nur schwer aussprechen können, weil man in Gedanken den Text immer „mitspricht“.
Natürlich müssen wir auch die rechtliche Seite der Namensgebung beachten. Gerade beim (Be-)Schreiben selbst erlebter Geschichten oder autobiografischer Romane darf man ohne Genehmigung der betreffenden Personen ihre Namen nicht nennen, will man sich nicht eine Klage wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts einhandeln. Schon mancher Roman musste eingestampft, das heißt vernichtet oder Textstellen mussten nachträglich geschwärzt werden, weil eine namentlich genannte Person, die mit der Veröffentlichung ihres Namens nicht einverstanden war, vor Gericht erstritt, dass das Buch nicht mit der Nennung ihres Namens verkauft werden durfte. Dasselbe gilt auch für das Aussehen sowie die gesamten Lebensumstände realer Personen. In dem Moment, wo ein Detail einen fundierten Rückschluss auf eine reale Person zulässt, kann es für Schreibende kritisch werden.
In der Regel gilt das für Fälle, in denen Autorinnen/Autoren die scheinbar oder tatsächlich porträtierte Person auch kennen. Glaubt sich jemand in unserer Story wiederzufinden, den wir gar nicht kennen und der auch keine „Person öffentlichen Interesses“ ist (z. B. Schauspieler oder Politikerin), bei der man voraussetzen kann, dass „alle Welt“ von ihr gehört hat, können wir sie nicht porträtiert haben. Hier ist die Ähnlichkeit tatsächlich der pure Zufall und das können wir dann auch beweisen. Allerdings urteilen die Gerichte in solchen Fällen sehr unterschiedlich. Es gibt Urteile, die Autorinnen/Autoren von jeder Persönlichkeitsrechtsverletzung freisprechen, obwohl sie nach dem Empfinden jedes gesunden Menschenverstandes eindeutig die ihnen bekannten Klagenden literarisch porträtiert hatten. Umgekehrt gibt es Fälle, in denen Autorinnen/Autoren schuldig gesprochen wurden, obwohl die angebliche Ähnlichkeit mit einer realen Person sich auf das gleiche Geschlecht und denselben Handlungsort der tatsächlichen Begebenheit beschränkte. Man kann vorher leider nie wissen, wie so ein Prozess ausgeht. Aus diesem Grund rate ich dringend davon ab, ähnliche Namen und/oder Personenbeschreibungen zu wählen, die Rückschlüsse auf die realen Personen zulassen. Wer eine „Susanne Schreiber“ in eine fiktive „Susi Schneider“ verwandelt und ihr womöglich noch das Aussehen von Susanne Schreiber verpasst, gibt einen eindeutigen Hinweis auf die reale Person. Solche Dinge lassen sich aber mit ein paar ganz einfachen Tricks vermeiden.
TRICK 1: Die „Geschlechtsumwandlung“
Ist die reale Person eine Frau, wird sie in der Geschichte zu einem Mann und umgekehrt. Selbstverständlich bekommt die fiktive Person einen Namen, der dem der realen Person nicht einmal entfernt ähnelt und auch nicht dieselben Initialen besitzt. Wenn aus einer realen Carla Schneider ein Karl Schneider wird, ahnt immer noch (fast) jeder, dass sich dahinter eben die echte Carla verbirgt.
TRICK 2: Das „Splitten“
Man verteilt die Charaktereigenschaften, Beruf, Familienverhältnisse etc. der realen Person auf mehrere Personen in der Geschichte. Ist die reale Person ein tyrannischer Bauunternehmer, geschieden, drei Kinder, so kann in unserer Geschichte/unserem Roman die Mutter der Hauptperson die Tyrannin sein, der Bauunternehmer wird zu einer ledigen Architektin, und die drei Kinder oder nur zwei gehören deren Schwester. Schon ist kein Rückschluss mehr auf die reale Person möglich, aber die realen Geschehnisse in Bezug auf die einzelnen Charaktereigenschaften können trotzdem „mit (anders) verteilten Rollen“ geschildert werden.
TRICK 3: Ortswechsel
Die Geschichte spielt auf keinen Fall in dem Ort, in dem sie sich real zugetragen hat oder auch nur in dessen Nähe. Idealerweise verlegt man sie noch in ein anderes (Bundes-)Land, und schon ist jede Ähnlichkeit getilgt.
Um ganz sicherzugehen sollten wir die Namen, die wir uns ausgesucht haben, besonders wenn es sich um Fantasyfiguren handelt, im Internet recherchieren. Wird ein Treffer oder werden sogar mehrere erzielt und ist einer davon der Name einer bekannten Persönlichkeit, sollten wir uns einen anderen ausdenken. Erhalten wir dagegen Millionen Treffer und die ersten davon gehören keinen „berühmten“ Persönlichkeiten, ist der Name häufig genug, dass konkrete Rückschlüsse auf eine bestimmte Person unmöglich sind und tatsächlich purer Zufall wären. Gerade bei Fantasyfiguren, die oft in (Online-) Rollenspielen oder Mangas vorkommen, haben die Erschaffenden der Spiele/Comics sich die Rechte an allen Namen als Markennamen gesichert.
Im Fall einer Veröffentlichung der Geschichte/des Romans sollten wir sicherheitshalber den Passus voranstellen: „Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden Personen oder tatsächlichen Begebenheiten wären Zufall.“ – Selbst, wenn das gelogen wäre. Solange wir unsere Figuren gut genug verfremdet haben, sind wir auf der sicheren Seite.
Eine Besonderheit bilden Schiffsnamen. Auch hier müssen wir die rechtliche Seite insofern beachten, dass wir reale Schiffsnamen, die zu einer bekannten Reedereikette gehören ohne Genehmigung der Reederei nicht verwenden dürfen. Wir dürfen unser Schiff also nicht „Costa Fortuna“ nennen, es aber durchaus „Fortuna“ taufen, sofern es kein Kreuzfahrtschiff ist, weil eben eine reale „Costa Fortuna“ als Kreuzfahrtschiff existiert. Auch bei Schiffsnamen gilt, dass sie zum „Charakter“ des Schiffes, d. h. zu der Art des Schiffes passen sollten. Ein Frachtkahn oder Riesencontainerschiff mit dem Namen „Elfenprinzessin“ klänge lächerlich, würde aber zu einer Segelyacht passen. Die wiederum verlöre an (literarischem) Charme, würde man sie nur nach ihrem Heimathafen, z. B. „Hamburg“ nennen, weil Lesende mit einer Yacht Urlaub, Südsee oder andere Exotik assoziieren. Rein formal müssen wir zwei Dinge beachten.
- Schiffe sind immer weiblich, auch wenn sie einen männlichen Namen tragen oder den eines Gegenstandes maskulinen oder neutralen Geschlechts. Egal ob das Schiff „Benjamin“ oder „Sylphe“ heißt, es ist immer DIE, sofern wir uns auf seinen Namen beziehen und nicht „das Schiff“ (es) meinen. Das gilt auch für Raumschiffe.
- Schiffsnamen werden immer in GROSSBUCHSTABEN geschrieben oder in Kapitälchen, die ein Wort zwar in Großbuchstaben schreiben, aber lediglich in der Größe normaler Kleinbuchstaben.
Mit originellen Namen sind wir immer auf der sicheren Seite.
In der nächsten Folge:
Figurennennung im Text
In weiteren Folgen:
Die Namensliste, Personenregister
Der Charakter
Die Ausdrucksweise
Handlungsmotive
Glaubhafte Reaktionen/Handlungen
Die „Personalakte“
Die Hauptfigur und ihr Gegenpart
Nebenfiguren
Broken Hero, der „gebrochene Held“