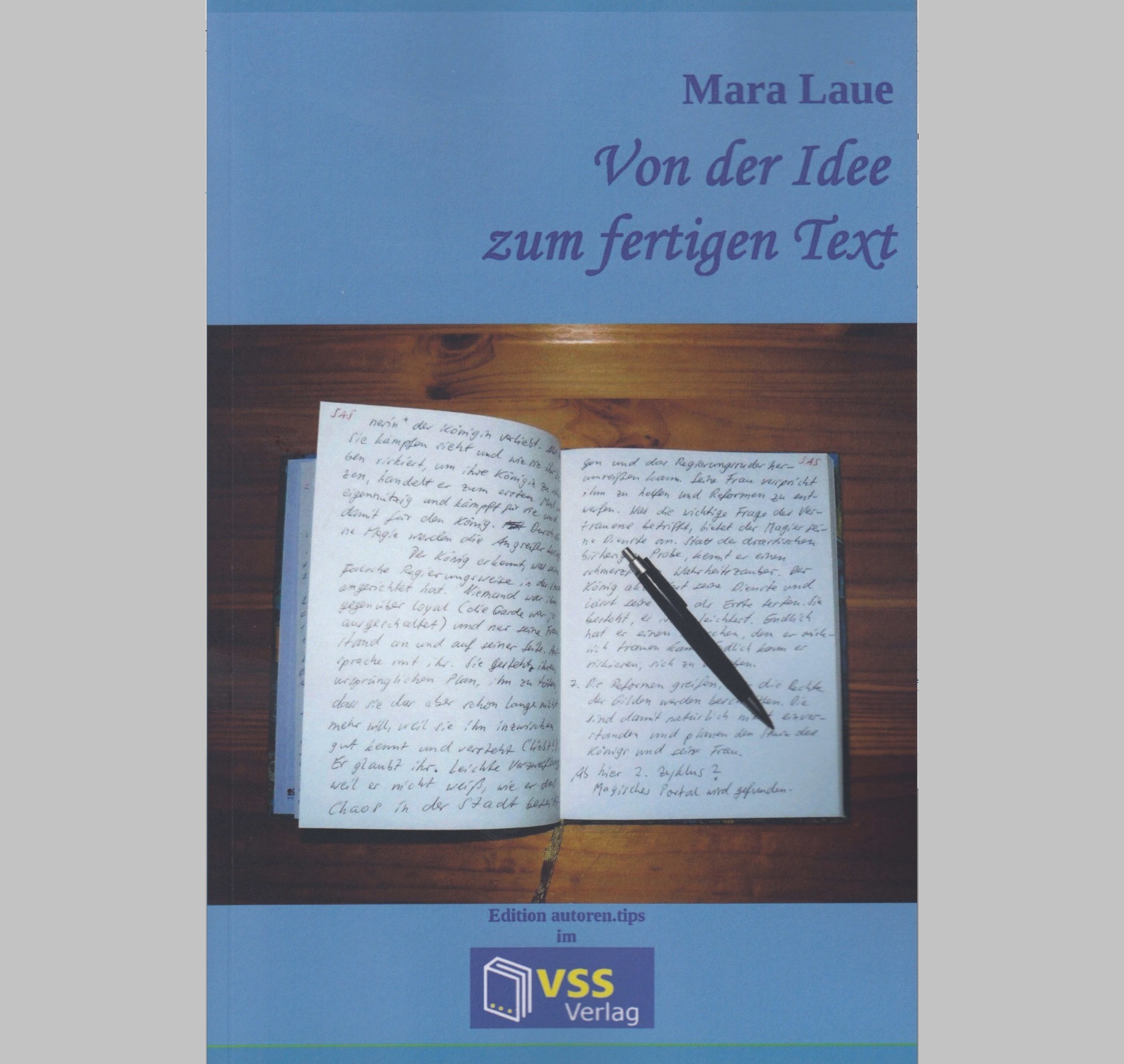Von der Kunst des Prosaschreibens – Zündende Klappentexte schreiben
Kluge Hinweise von Mara Laue
Der Klappentext oder Covertext auf der Rückseite des Buches ist die nur wenige Sätze umfassende Inhaltsangabe. Da er die Lesenden zum Kauf verführen soll, ist er besonders spannend, verrät aber nie das Ende. Früher war die Gestaltung des Klappentextes Sache des Verlages. Die meisten Verlage hatten sogar ihre Spezialist/innen dafür, die das Manuskript lasen und daraus einen appetitanregenden Klappentext konstruierten. In der heutigen schnelllebigen Zeit sparen sich die meisten Verlage diese Leute nicht nur, sie erwarten auch von den Autorinnen/Autoren, dass sie ihren Klappentext selbst schreiben.
Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, denn wir kennen unseren Roman schließlich am besten. Allerdings will das Entwerfen eines zündenden Klappentextes wohl überlegt und gelernt und noch mehr geübt sein.
War das Kürzen beim Exposé schon eine Qual, so ist es das beim Klappentext erst recht. Denn hier gilt, dass ein guter Klappentext nicht mehr als maximal 800 Anschläge haben sollte. Das sind, je nach Format des Buches, 12 bis 15 Zeilen. Je weniger, desto besser. Ein Ding der Unmöglichkeit, will es einem scheinen, aber wie so vieles ein Ding, das man lernen kann.
Es gibt einige Strategien, wie man einen guten Klappentext entwerfen kann. Die Wichtigste ist:
Wir lassen ALLES weg, was nicht zum Kernpunkt der Geschichte gehört!
Leichter gesagt als getan, denn der Kernpunkt der Geschichte ist nicht die Prämisse, die unserem Plot zugrunde liegt, und auch nicht seine „Botschaft“ als Kernaussage (sofern er eine hat), sondern für den Klappentext der zentrale Konflikt, welcher der Hauptfigur zu schaffen macht. Eventuell können ein oder zwei Sätze den Lesenden sagen, wie es zu diesem Konflikt gekommen ist. Beschreiben wir den Konflikt kurz und prägnant und schließen den Klappentext mit einem Cliffhanger oder einem Geheimnis ab oder wir deuten eine Gefahr für die Hauptfigur an.
WICHTIG:
Für viele Lesende ist der Klappentext nach dem Titel (und evt. dem Titelbild) DAS Kaufkriterium!
Für den Klappentext sind folgende Dinge zu beachten:
- Sein Inhalt dreht sich nur um die Hauptperson der Geschichte. Sie steht im Mittelpunkt.
- Wir konzentrieren uns auf den zentralen Konflikt und den Kernpunkt der Geschichte.
- Wir werfen ein Schlaglicht auf das wichtigste Kriterium der Romanhandlung.
- Wir vermeiden Erklärungen.
- Wir formulieren den Text so spannend, dass die Lesenden unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht und deshalb das Buch kaufen.
- Wir deuten ein Geheimnis oder ein Rätsel (im weitesten Sinn) an, das die Lesenden lüften möchten.
- Aber Vorsicht! Wir dürfen im Klappentext nichts„versprechen“, was der Roman nicht hält. Das nehmen die Lesenden sehr übel. Banales Beispiel: Heißt es im Klappentext, das Opfer eines Verbrechens wird erstochen, im Roman aber vergiftet, sind die Lesenden enttäuscht, weil sie eine Messerattacke erwartet haben. Oder wenn der Klappentext eine Nebenfigur in den Mittelpunkt stellt, sich beim Lesen aber eine andere Figur als Hauptperson entpuppt. Was wir schreiben, muss hundertprozentig stimmen.
Nehmen wir an, in unserem Roman geht es darum, dass zwei Freundinnen denselben Mann lieben, der zuerst mit der einen, dann mit der anderen anbandelt, worauf die Betrogene ihn ermordet und die Tat der Freundin anhängen will. Alle (teilweise fingierten) Indizien sprechen gegen die Beschuldigte. Eine Verurteilung scheint unabwendbar, denn niemand glaubt ihrer Unschuldsbeteuerung, weil eben alles gegen sie spricht. Da ergreift die Beschuldigte die Flucht, um auf eigene Faust den Täter zu finden. Das passt der Mörderin natürlich gar nicht, sodass sie plant, nun auch die ehemalige Freundin zu ermorden. Aber am Ende kommt natürlich die Wahrheit an den Tag.
Welche dieser Informationen nehmen wir nun für den Klappentext? Nicht das Ende und auch nicht, wer die wahre Täterin ist oder dass der Mord von einer Frau begangen wurde. Alles andere können wir verwenden, müssen es aber spannend verpacken. Zum Beispiel so:
Als Sophia von einem Seminar nach Hause kommt, findet sie nicht nur ihren Freund ermordet in der gemeinsamen Wohnung, sondern sie selbst steht obendrein unter Mordverdacht. Alle Indizien sprechen gegen sie. Als sich die Schlinge immer mehr um ihren Hals zusammenzieht, flieht sie, um ihre Unschuld zu beweisen. Doch nicht nur die Polizei heftet sich unerbittlich an ihre Fersen, auch der Mörder verfolgt sie. Denn er kann nicht zulassen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. (472 Anschläge)
Hier erzählen wir den Lesenden, dass Sophia unschuldig ist, da sie erst nach Hause kommt, als der Mord bereits geschehen ist. Wir offenbaren, warum sie trotzdem unter Verdacht gerät: Die Indizien sprechen gegen sie und sind wohl lückenlos. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Geschichte, dem Kernpunkt: Sophia flieht und will auf eigene Faust den Täter ermitteln. Dass das ein schwieriges Unterfangen wird, welches mit einem Haufen von Action, brenzligen Situationen, Fehlschlägen und Beinaheverhaftungen vonstatten geht, vielleicht sogar mit einem zweiten Toten, der ihr angelastet wird, setzen alle Lesenden, die sich für so einen Stoff interessieren, voraus. Die zusätzliche Komplikation: Auch der Mörder verfolgt sie, weil sie die Wahrheit nicht erfahren darf. Dass er das mit Mord(versuch) zu verhindern trachtet, setzen Krimifans als genretypisch voraus.
Was dieser Klappentext nicht verrät und auch nicht verraten darf ist, dass der Mörder eine Frau und Sophias und ihres toten Freundes betrogene Freundin ist. Was die Lesenden u. a. auch wissen möchten, ist das Motiv für den Mord und wie es der Täter fertigbekommen hat, alle Spuren so zu fingieren, dass Sophia schuldig erscheint, die doch gar nicht da war und deshalb eigentlich ein Alibi haben müsste.
Und wir sehen auch: Hier dürfen, hier müssen wir sogar auktorial berichten, um unsere künftigen Lesenden zu ködern.
Eine weitere Möglichkeit, das Interesse der Lesenden zu wecken, ist, eine Art Überschrift dem eigentlichen Klappentext voranzustellen, die das Wichtigste in Schlagworten zusammenfasst:
- Ein entführter Waffeningenieur, ein Profikiller und ein mörderischer Plan
- Wer aus der Hölle zurückkehrt, ist nie mehr derselbe
- 7 Opfer, 2 unerbittliche Gegner, 1 perfider Plan
- Traue niemals einem Anwalt, einem Scharfschützen oder einer Frau – erst recht nicht, wenn sie alles in einem ist.
Nach solchen Andeutungen lesen fast alle Interessierten erst recht auch den Rest des Klappentextes, von dem sie sich nähere Erklärungen zu diesem Spannung versprechenden Auftakt erhoffen. Verstärkt der nachfolgende Text den Eindruck von Spannung und einem interessanten Plot, wird das Buch gekauft.
Ein paar weitere Beispiele spannender Klappentexte:
Titel: Stein, Papier, Schere (Krimi)
Isabella, Svenja und Yasmin treffen sich jeden Freitagabend in einer Bar, um einen Mann abzuschleppen und losen mit dem Spiel „Stein, Papier, Schere“ aus, welche von ihnen die Verführerin sein darf. Als Svenja nach einer Nacht mit einem Fremden tot aufgefunden wird, glaubt Kommissar Gero Marboom, es mit einer leicht zu klärende Tat zu tun zu haben. Aber dann wird auch Isabella ermordet, und Yasmin fühlt sich zunehmend verfolgt. Als Maiboom begreift, dass „Stein, Papier, Schere“ noch eine ganz andere, hochbrisante Bedeutung hat, ist es beinahe zu spät, denn der Mörder ist längst auch hinter ihm her. (601 Anschläge)
Analyse:
Der wichtige Ausgangspunkt der Story ist das erotische Freitagabendspiel der drei Freundinnen. Nicht nur deshalb muss es genannt werden, damit die Lesenden den Hintergrund verstehen, sondern auch, weil, wie sich später herausstellt, der Name des Losverfahrens noch eine andere Bedeutung hat. Hauptperson des Romans ist Kommissar Gero Marboom. Er ermittelt in dem ersten Mord. Dann die erste überraschende Wende: Was wie ein „leichter“ Fall aussieht, ist komplizierter, denn auch die zweite Freundin des Trios wird ermordet und Nummer drei ist offensichtlich ebenfalls in Gefahr. Es folgt die nächste Überraschung: Der Name des Losspiels hat eine „hochbrisante“ Bedeutung (hier wird ein Rätsel angedeutet) und ist nicht nur das harmlose Spiel, das jeder kennt. In den Lesenden baut sich (zusätzliche) Spannung auf: Was mag das bedeuten, was sich hinter dem Namen verbergen? Als Cliffhanger folgt die Gefahr für den Helden Marboom: Der Mörder hat es auch auf ihn abgesehen. Und man fragt sich, ob der Grund dafür wirklich nur darin begründet ist, dass der Kommissar das Geheimnis von „Stein, Papier, Schere“ gelüftet hat oder ob noch etwas anderes dahintersteckt. Und weil die Lesenden alle diese Fragen beantwortet haben möchten, werden sie das Buch kaufen.
Titel: Rabenträume (Dark Romance)
Als Kopfgeldjägerin sorgt Raven Skysong dafür, dass flüchtige Verbrecher zu ihren Verhandlungen vor Gericht erscheinen. Doch ihr einziges Ziel ist es, die Gang zu finden, die ihre Familie ermordet hat. Als sie Dylan Cutter als neuen Partner bekommt, merkt sie schnell, dass er etwas vor ihr verbirgt. Außerdem scheint er den Verbrecher, den sie gemeinsam jagen sollen, ziemlich gut zu kennen. Als Raven seinem Geheimnis auf die Spur kommt, wird Dylan nicht nur unversehens zu ihrem Feind, die Mörder ihrer Familie haben obendrein den Spieß umgedreht und die Jagd auf sie eröffnet. (580 Anschläge)
Analyse:
Die Heldin wird bereits im ersten Satz erwähnt: Raven Skysong. Ihr Name verrät, dass sie zu den First Nations gehört. Erstes ungewöhnliches „Accessoire“: Ihr Beruf als Kopfgeldjägerin. Der verrät den Lesenden, dass sie eine taffe, kampferprobte Frau mit detektivischem Gespür ist. (Und weil es sich um einen Liebesroman handelt, ist sie garantiert nicht hässlich.) Der Kernpunkt der Geschichte: Raven will die Mörder ihrer Familie finden. Durch diese Feststellung werden den Lesenden gleich mehrere Informationen gegeben: Der Mord muss schon länger zurückliegen, mindestens ein paar Monate, weil die Polizei natürlich nicht untätig war und die Mörder gesucht, aber nicht gefunden hat und der Fall offensichtlich – und vermutlich mangels Spuren, die zu der Gang führen könnten oder wegen Vorurteilen gegen Mitglieder der First Nations – momentan für sie keine Priorität (mehr) genießt. Gerade bei einem Massenmord, dem eine ganze Familie zum Opfer fiel, gibt die Polizei normalerweise nicht schon nach ein paar Tagen oder Wochen auf. Raven hat nicht nur aufgrund ihres Berufes teilweise bessere Möglichkeiten und vor allem die Zeit, eigene Ermittlungen anzustellen, was sie auch tut, denn die Gang zur Rechenschaft zu ziehen, ist „ihr einziges (wahres) Ziel“.
Nun folgt der Konflikt. Sie bekommt einen neuen Partner, der nicht ganz koscher ist, Geheimnisse hat, evt. mit Verbrechern gemeinsame Sache macht. Da es sich bei dem Roman um einen Liebesroman handelt, ist für die Lesenden dieses Textes klar, dass es zwischen den beiden funkt, was den Konflikt verschärft, weil Raven Dylan Cutter nicht traut und zwischen ihrer Zuneigung/Liebe und dem Misstrauen hin und her gerissen ist. Ihr Misstrauen entpuppt sich als gerechtfertigt, denn als sie seinem Geheimnis auf die Spur kommt, wird er zu ihrem Feind. Die Lesenden ahnen, dass er vielleicht etwas mit dem Mord an ihrer Familie zu tun haben könnte oder zumindest etwas darüber weiß. Vielleicht ist er nur deswegen ihr Partner geworden, um in Erfahrung zu bringen, was sie bereits herausgefunden hat. Weil es eine Liebesgeschichte ist, die ein genretypisches Happy End voraussetzt, kann er letztendlich nicht zu den Bösen gehören, auch wenn es zunächst so scheint. Die Lesenden werden neugierig, was sein Geheimnis ist und wie das alles zusammenhängt.
Als „krönender Abschluss“ des Klappentextes die Gefahr für die Heldin: Die Mörder ihrer Familie wollen sie töten und jagen sie. Weil das im selben Satz genannt wird wie Ravens Erkenntnis, dass Dylan Cutter ihr Feind ist, scheint nun nahezu festzustehen, dass er mit den Mördern ihrer Familie in Verbindung steht. Und die erfahrenen Fans von Liebesromanen wissen, dass sich in dieser Situation zeigen wird, aus welchem Holz Dylan wirklich geschnitzt ist und dass die Liebe der beiden zueinander sich beweisen muss. Aber wie? Spannend! Buch kaufen!
Titel: Das Sekhmet-Projekt (Thriller)
Als Dr. Scott Willowby seine einsame Waldhütte erreicht, findet er dort eine schwer verletzte Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat. Seine Nachforschungen ergeben, dass sie mit einem geheimen Projekt namens „Sekhmet“ zu tun hat, bei dem es um Genmanipulationen an Menschen geht. Doch als Scott erkennt, welche Rolle die Unbekannte bei diesem Projekt tatsächlich spielt, gerät nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern auch seine gesamte berufliche und private Existenz. (467 Anschläge)
Analyse:
Der Held wird im ersten Satz eingeführt: Scott Willowby. Sein Doktortitel besagt, dass er vermutlich Arzt oder Wissenschaftler ist, vielleicht beides. Kernpunkt der Geschichte: Er findet in seiner abgelegenen Waldhütte eine Frau ohne Gedächtnis, die schwer verletzt ist. (Die „Abgelegenheit“ wird garantiert noch eine wichtige Rolle im Roman spielen, andernfalls sie nicht im Klappentext betont werden müsste/würde.) Die Frage, wer die Frau verletzt hat und wie sie in die „einsame“ Gegend gekommen ist mit ihren schweren Verletzungen, stellt sich nicht nur (unausgesprochen) Dr. Willowby, sondern auch den Lesenden. Weil er wahrscheinlich Arzt ist, ahnen die Lesenden, dass er die Frau in seiner Hütte gesund pflegt. Aber etwas muss mit ihr (von den genannten Dingen abgesehen) nicht stimmen, andernfalls er keine Nachforschungen anstellen würde und sie wohl auch schnurstracks ins nächste Krankenhaus gebracht hätte; spätestens nach der Erstversorgung ihrer Wunden. Es muss für ihn also einen gewichtigen Grund geben, das Nächstliegende (Transport ins Krankenhaus) nicht zu tun. Welcher mag das sein?
Dann die Erkenntnis, dass die Frau mit einem Projekt zu tun hat, das (selbstverständlich illegale) Genmanipulationen an Menschen vornimmt. Man weiß dadurch, dass die Frau mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein „Opfer“ dieses Projekts ist und dass sie deshalb in Gefahr schwebt. Aber nun auch Willowby, weil er auf etwas gestoßen ist, das die Täter garantiert unter allen Umständen geheimhalten wollen und müssen. Schlussfolgerung der Lesenden: Die gedächtnislose Frau sollte beseitigt werden, damit sie niemandem von dem Projekt erzählen kann.
Es folgt der zentrale Konflikt: Willowby findet heraus, welche Rolle die Frau tatsächlich in dem Projekt spielt, was seine gesamte Existenz in tödliche Gefahr bringt. Schlussfolgerung: Die Frau ist nicht so harmlos, wie sie zuerst erschienen ist und vermutlich nicht nur oder überhaupt Opfer, sondern gehört womöglich zu den Tätern = noch größere Gefahr für Willowby.
Wer sich mit ägyptischer Mythologie auskennt, dem verrät der Name des Projekts noch ein Stück mehr: Sekhmet ist eine blutdürstige Kriegsgöttin und der Inbegriff von Furcht und Schrecken. Doch auch ohne diese Information ist den Lesenden klar, dass Dr. Willowby alle Hände voll zu tun hat, um mit dem Leben davonzukommen. Die Lesenden fragen sich: Ist die Unbekannte Freundin, Feindin oder gar beides abwechselnd? Um das zu erfahren, werden sie das Buch kaufen.
Titel: „Das Schwert der Zentauren“ (Fantasy)
Die Tigani-Kriegerin Tana und ihre Leute werden verdächtigt, ein heiliges Schwerter der Zentauren gestohlen zu haben. Um das Leben ihrer Mitreisenden zu retten, die von den Zentauren als Geiseln festgehalten werden, muss Tana das Schwert zurückbringen. Zusammen mit dem Greif Namak und dem Zentaurenhäuptling Elmon begibt sie sich auf die gefahrvolle Suche. Aber um die Zauberin der Blutgilde zu besiegen, die es gestohlen hat, muss Tana den mächtigsten Hexenmeister von Dáskarun aus dem Reich der Toten befreien. Doch der König der Toten verlangt dafür einen ungewöhnlichen Preis. (575 Anschläge)
Analyse:
Auch hier wird die Heldin im ersten Satz genannt: Tana, eine Tigani-Kriegerin. Weil „Tigani“ kein „Allerweltsbegriff“ im Fantasygenre ist, werden sich die Lesenden fragen, was das ist, ihn aber wahrscheinlich für einen Stammesnamen halten. Der aber für die Handlung wichtig sein muss, sonst hätte es genügt, nur „die Kriegerin Tana“ zu schreiben. (Im Roman offenbart sich: Die Tigani sind keine Menschen, sondern ein katzenähnliches Volk, das die Fähigkeit besitzt, unsichtbar durch Wände zu gehen.)
Im selben Satz wird offenbart, worum es geht: Tana oder einer ihrer Leute soll den Zentauren ein heiliges Schwert gestohlen haben. Schon im nächsten Satz wird der erste Konflikt thematisiert: Die Zentauren erpressen Tana mit dem Leben ihrer Mitreisende, das Schwert zurückzugeben. Für Tana steht also sehr viel auf dem Spiel. Weil sie die Heldin ist, ist den Lesenden sofort klar, dass sie unschuldig ist.
Als Nächstes folgt etwas Ungewöhnliches: ein Greif begleitet sie. Hier wird zusammen mit den Zentauren und den unbekannten Tigani den Lesenden etwas Besonderes geboten, denn solche Figuren kommen in der Mehrheit aller Fantasyromane und -geschichten (noch) relativ selten vor. Schon dieses Ungewöhnliche verspricht zusätzliche Spannung, weil die Lesenden aufgrund dessen die Handlung nicht wie bei z. B. Elfen, Drachen, Trollen etc. voraussehen können.
Nun folgt der Hauptkonflikt: Die wahre Diebin ist eine Zauberin der Blutgilde, was andeutet, dass sie eine ziemlich gefährliche Person ist: Blutgilde = Blutopfer = Ritualmord(e). Und garantiert braucht sie das Schwert für einen üblen Zauber. Sie ist aber so mächtig, dass weder Tana noch irgendein lebender Mensch sie besiegen kann. Der Einzige, dem das gelingen könnte, ist ein längst toter Hexenmeister. Tana muss, um das Leben ihrer Leute zu retten, den Hexenmeister aus der Unterwelt holen. Die Lesenden können sich denken, dass das per se ein schwieriges und vor allem lebensgefährliches Unterfangen wird.
Es folgt ein Cliffhanger als Abschluss: Der König der Toten fordert „einen ungewöhnlichen Preis“ von Tana dafür, dass er den Hexenmeister gehen lässt. Was mag das sein? Das können sich selbst erfahrene Fantasy-Fans nicht ohne Weiteres denken. Wenn sie die Antwort bekommen möchten, müssen sie das Buch lesen.
Wir sehen an diesen Beispielen, dass viele Dinge im Klappentext „zwischen den Zeilen“ ausgedrückt sind. Auch muss nicht zwangsläufig die Hauptperson im ersten Satz genannt werden. Wie bei „Stein, Papier, Schere“ ist es manchmal für das Verständnis der Handlung und das, was die Hauptfigur zu tun hat, erforderlich, dass die „Vorgeschichte“ angerissen wird.
Wenn man sich die Klappentexte noch einmal durchliest, erkennt man aber auch, dass an keiner Stelle ein überflüssiger Satz steht, der mit der eigentlichen Haupthandlung, dem Konflikt, um den es geht, nichts zu tun hat. Wir sehen auch, dass jedes Wort eine wichtige Bedeutung hat, z. B. die Erwähnung der „abgelegenen“ Waldhütte. Wäre das nicht wichtig, hätte es genügt, nur „Waldhütte“ zu schreiben. Oder die Erwähnung, dass die Diebin des Zentaurenschwertes zur „Blutgilde“ gehört. Ohne diesen Hinweis auf ihre damit verbundene Grausamkeit/Skrupellosigkeit wäre manchen Lesenden nicht klar, warum ein Toter aus der Unterwelt zurückgeholt werden muss, statt „einfach“ ein paar mächtige lebende Zauberleute darauf anzusetzen, die Diebin zur Strecke zu bringen.
Versuchen wir, unsere Klappentexte nach diesen Kriterien zu entwerfen. Lassen wir die Entwürfe immer ein paar Tage liegen, bevor wir sie überarbeiten. Mit etwas Abstand vom Text werden wir seine möglichen Schwächen leichter entdecken.
Abschlussfolge:
Manuskriptnorm und Verlagsanschreiben