Wie es sein könnte und vielleicht schon wird – John Lanchesters „The Wall“ rezensiert
von Walther
John Lanchester, The Wall, Faber & Faber London 2019, ISBN 978-0-571-29873-0, Paperback, 276 S., £ 8,99
auf Deutsch erschienen als: Die Mauer – aus dem Englischen von Dorothee Merkel, Klett-Cotta, Stuttgart 3. Druckaufl. 2019, 348 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN: 978-3-608-96391-5, € 24,00
Der Rezensent hat sich angewöhnt, englischsprachige Literatur grundsätzlich im Original zu lesen. Das ist nur am Rand darauf zurückzuführen, dass die Übersetzungen als solche prinzipiell schlecht sind. Es gibt kongeniale Übertragungen aus allen Sprachen ins Deutsche: genauso häufig findet man den anderen mehr als gelungenen Weg aus dem Deutschen in die jeweilige Fremdsprache. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Das liegt am Idiomatischen, an den Metaphern, die in jeder Sprache auf andere historische Bezüge und besondere soziale und kulturelle Besonderheiten verweisen. Zudem hat jeder Autor eine spezielle Färbung und Art, mit denen er oder sie berichtet und erzählt. Auch das wird beim Übersetzen interpretiert und nicht selten von der Sprachmelodie des Übersetzers zugedeckt.
Das ist auch bei John Lanchesters The Wall so, der natürlich auf dem Boden der Brexit-Debatte fußt und aus ihm herauswächst. In Deutschland hat die Begrifflichkeit „Die Mauer“ ein ganz anderes Assoziationsnetz, das sie mit sich bringt. Die Berliner Mauer, auch im Englischen als „the Wall“ bekannt, hatte einen anderen Zweck: Sie sollte Menschen davon abhalten zu gehen. Im Roman, der Gegenstand dieser Besprechung ist, sollen Menschen daran gehindert werden zu kommen.
Der aktuelle Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie erschreckt zusätzlich. Es bedarf nicht der Abschottung der EU-Außengrenzen und der geradezu reflexartigen Abwehr aller Fremden, deren emotionale Fundierung auch der Auslöser des Brexit ist: „We got to get back control!“ war und ist das Mantra aller Fremdenfeinde. Die Pandemie hat selbst die totale Abschottung innerhalb Europas wieder auf die Tagesordnung gebracht; für Kanadier und US-Amerikaner entlang der langen Grenze zwischen beiden Ländern kommt die jetzt gültige Grenzschließung der Apokalypse nahe. Präsident Trump lässt unter Plünderung anderer Haushalte die Mauer an der Südgrenze errichten, um die Armutswanderung aus Süd- und Mittelamerika einzudämmen.
Lanchesters Dystopie hat diese Ansätze perfektioniert. Das Grenzregime ist das, was die chinesischen Kaiser beim Bau der Chinesischen Mauer gerne gehabt hätten. Die Patrouillien gab es bereits, und auch damals erging es denen schlecht, die einen Überfall aus der mongolischen Steppe nicht stoppten. Nur gibt es für die Eindringlinge in The Wall keinen Schutz, weil ihnen das Implantat fehlt, dass ihre berechtigte Existenz dokumentiert. Wer die Mauer überwindet, wird früher oder später entdeckt und, wenn er Glück hat, versklavt.
Damit sei genug verraten. Die Bezüge sind erkennbar, und je länger man liest, desto deutlicher wird, warum dieser Roman auf der Shortlist des Pulitzer-Preises 2019 stand. Das Buch ist eine Warnung, wie es werden kann, wenn die Menschheit so weiter macht: politisch, in Sachen Umwelt- und Ressourcenverbrauch und im Umgang miteinander. Auch wenn der Inhalt nicht gerade erfreut, bleibt es eine Leseempfehlung – zur Not auch in der deutschen Übersetzung, wenn es denn sein muss.

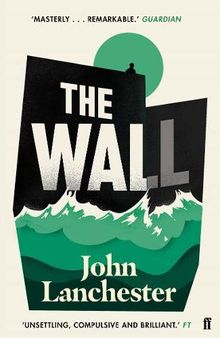
One thought on “Wie es sein könnte und vielleicht schon wird – John Lanchesters „The Wall“ rezensiert”