With a Little Help
von Irina Schlicht
»Wollen Sie Hilfe?«, rufe ich von der Brücke hinunter.
Der Mann strampelt im Wasser, scheinbar sorglos, als wäre es Sommer, und er würde im Großen See baden. Doch es ist März – Höchsttemperatur des heutigen Tages 9° C. Die Wassertemperaturen melden sie in den Nachrichten erst ab Juni –, und ich stehe am Industriekanal. Weißliche Brühe schäumt aus einem Seitenrohr und verteilt sich in sprudelnden Ringen in dem dreckig-braunen Wasser. Wenn er nicht ertrinkt, wird er sich vergiften, denke ich. Er hält sich an einem schmalen Holzbrett fest – wie Treibholz.
Warum musste ich ihn nur ansprechen? Er scheint sich nicht zu quälen und auch nicht um sein Leben zu bangen. Dieses fürchterliche Helfersyndrom in mir. Andere leiden am Messie-Syndrom oder am Arm-Schulter-Syndrom. Ich bin am Helfersyndrom erkrankt. Seit frühester Jugend. Ich reibe mich für meine Mitmenschen auf.
»Ob ich Hilfe haben will?«, fragt er nach. »Nein! Wollen nicht«, ruft er mit fester Stimme zu mir herauf.
Was für eine herausfordernde Formulierung! Und ich falle darauf herein wie ein Süchtiger, der die nächste Schnapsrunde nicht auslassen kann. »Aber brauchen, was? Sie brauchen Hilfe!«, rufe ich, fast frohlockend.
Es könnte ein Achselzucken gewesen sein, dass seine Hände kurz vom Holzbrett abrutschen. Doch er bekommt es gleich wieder zu fassen.
»Brauchen vielleicht, aber eben nicht wollen«, schreit er zu mir nach oben.
»Und wenn Sie keinen freien Willen haben?«, gebe ich zu bedenken.
»Dann wäre es schwierig«, gibt er zu. »Wenn ich keinen freien Willen hätte, würde ich wohl Hilfe brauchen. Aber ich bin aus freien Stücken in diese kalte Brühe gestiegen.«
»Was macht Sie da so sicher, dass es Ihr freier Wille war?« Ich lasse nicht locker. »Kennen Sie nicht die neuesten Erkenntnisse aus der Gehirnforschung?«
Ich ziehe meinen Trumpf aus der Tasche. »Wir haben keinen freien Willen!«
Er lässt mich ins Leere laufen, reagiert nicht und plätschert entspannt weiter. Anthrazitblaue Wolken ziehen von Osten auf, das Licht wird fahler, nur im Westen schimmern noch die Silhouetten der nackten Platanen im Abendrot. Ich fröstele.
Es war wie ein innerer Zwang, ich musste diesen im Wasser treibenden, vielleicht nur meditierenden, Mann erneut ansprechen. Er würde bestimmt nicht reagieren ´,und dann hätte ich eben alles in meiner Macht Stehende getan und würde entlastet und guten Gewissens nach Hause gehen können.
»Unterstellt, Sie hätten einen freien Willen, wollen Sie sich denn umbringen?«
Er antwortete prompt: »Ja natürlich, was denken Sie denn? Meinen Sie, ich will hier Wasserproben für den Monat März entnehmen?«
»Also bräuchten Sie Hilfe, dass Sie endlich untergehen können?«
»Ja, wenn Sie es so aussprechen. Das ist es. Ich brauche Unterstützung zum Selbstmord.«
»Wollen Sie die denn auch, die Unterstützung zum Suizid?«
»Fangen Sie doch nicht schon wieder mit Ihrer Freien-Willen-Diskussion an! Das kann einem in den letzten Minuten ja völlig den Atem nehmen.«
»Dann wären Sie an Ihrem Ziel«, meinte ich lakonisch. »Aber vielleicht ist es doch gar nicht Ihr Ziel? Denn warum halten Sie sich eigentlich an dem Brett fest, wenn Sie ertrinken wollen?«
»Na, ist doch klar«, antwortete er fast entrüstet. »Sonst müsste ich doch schwimmen, und das ist mir zu anstrengend.«
Ein fauler Selbstmörder, dachte ich. »Können Sie denn schwimmen?«
»Was denken Sie denn?«, rief er aufgebracht. »Ich war Leistungsschwimmer!«
»Wie bitte? Und dann gehen Sie ins Wasser, um sterben zu wollen? Das kann doch nicht klappen. Da sind Sie doch genau in Ihrem Element.«
»Ich habe auch einen Neoprenanzug an, damit ich nicht so schnell auskühle.«
»Also schaue ich hier auf einen ziemlich albernen Selbstmörder hinunter«, spottete ich.
»Sie beleidigen mich!«
»Und Sie stehlen mir meine Zeit!«
»Sie haben doch mit dem Gequatsche angefangen! Sie wollten mich doch unbedingt retten.«
»Ja, das stimmt«, gab ich kleinlaut zu.
»Und? Wollen Sie mich denn nun retten? Also, vorausgesetzt Sie haben einen freien Willen, Sie wissen schon, was ich meine.«
»Na klar will ich Sie retten. Also vielleicht will auch nur mein Helfersyndrom Sie retten. Aber an sich ist das doch egal, was Sie im Endeffekt rettet. Hauptsache, Sie kommen da aus dem kalten, giftigen Wasser heraus.«
»Nee, darum geht’s doch überhaupt nicht. Ich merke schon, Sie wollen mich nur aus dem Kanal herausbringen, aber das kann ich auch allein.«
»Was wollen Sie denn dann?«
»Na, ich will mit Ihnen reden.«
»Das tun wir doch gerade.«
»Ja, aber nur solange ich hier im Wasser treibe und Sie meinen, Sie müssten mir heraushelfen.«
Ich nickte unwillkürlich.
»Sehen Sie, und das ist die Gemeinheit! Sobald ich aus dem Wasser heraus und wieder im Trockenen bin, ist Ihr angeblich so menschenfreundlicher Hilfeakt beendet. Vielleicht laden Sie mich noch auf eine heiße Brühe oder einen heißen Tee ein und rufen mich noch mal nächste Woche an, ob ich mir auch keine Lungenentzündung geholt habe. Aber das wär’s dann. Mehr Hilfe ist in Ihrem Helfersyndrom nicht drin. Dass ich jemanden zum Reden brauche, und zwar jeden Tag, dass mich die vier Wände meines düsteren Zimmers erdrücken, dass ich nachts nur Albträume habe, in denen ich immer wieder erschossen werde, dass ich seit zehn Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen habe, das ist Ihnen alles völlig egal!«, brüllte er mich an.
»Das ist doch aber auch nicht meine Schuld!« Ich brüllte zurück.
»Natürlich nicht«, seine Stimme wurde leiser. »Aber es ist auch nicht Ihre Schuld, dass ich hier im Wasser treibe, und trotzdem wollen Sie mir ins Trockene verhelfen.« Er sprach noch leiser, fast wie zu sich selbst. »Warum wollen Sie mir nicht helfen, wenn es um das geht, was ich wirklich brauche?« Ich hatte mich weit über das Brückengeländer gebeugt, um diesen letzten Satz noch zu hören.
Und dann verschluckte ihn die Dunkelheit. Ich hörte es noch ein paar Mal plätschern, und plötzlich war Stille. Auch das Sprudeln aus dem Seitenrohr hatte aufgehört. Mein Gott, durchfuhr es mich, jetzt hat er es doch wahrgemacht und sich ertränkt. Und ich hätte ihn retten können. Ich rannte an das Ende der Brücke und stürmte die Treppe an der Böschung hinunter. Fast wäre ich in der Dunkelheit gestürzt. In Umrissen erkannte ich den Rettungsreifen, riss ihn aus der Halterung und rief lauthals: »He, wo sind Sie?«, aber es blieb still. Trotzdem schmiss ich den Reifen in den Kanal, er würde ihn entdecken, er war Leistungsschwimmer. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Der Ring platschte auf die Wasseroberfläche, die Leine behielt ich in der Hand und wartete gespannt – wie ein Angler, der auf das Anbeißen des Fisches wartet.
Warum hatte ich ihm nicht zugesagt, dass ich mich um ihn kümmern würde? Ich fühlte mich elend. Er war bestimmt untergegangen. Ich hätte ihn retten können. Ich! Ja, ich! Hatte ich nicht irgendwann einmal einen Eid geschworen, dass ich jedem Menschen, der in Not ist, helfen würde?
Klar, ich habe wahnsinnig viel Arbeit in der Praxis, aber jeden Tag ein Zehn-Minuten-Telefonat, das hätte ich ihm doch versprechen können. Das wäre einzurichten gewesen. Ich fror. Die Leine ruhte bewegungslos in meiner Hand. Wie lange sollte ich hier noch warten? Ich hatte einen Menschen auf dem Gewissen. Ich hätte ihn retten müssen. Der Satz hämmerte in meinem Kopf. Ich bin schuld an dem Tod dieses Mannes. Ich hätte ihn retten müssen.
Ich weiß nicht, wie lange ich da verloren in der Dunkelheit am Ufer des Industriekanals gestanden hatte. Irgendwann warf ich wie automatisch die Leine in das düstere Wasser und stieg schwerfällig Stufe für Stufe die Treppe zur Brücke nach oben. Es war nun stockdunkel. Mit schleppenden Schritten ging ich nach Hause. Ich wurde den Satz nicht los. Ich hätte ihn retten müssen. Immer wieder schrie es in mir: Ich hätte ihn retten müssen.

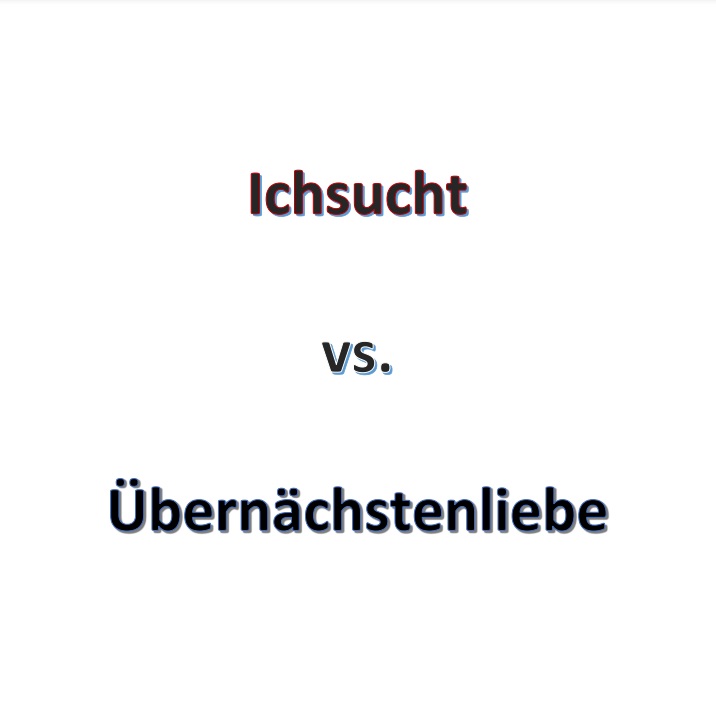
One thought on “With a Little Help”